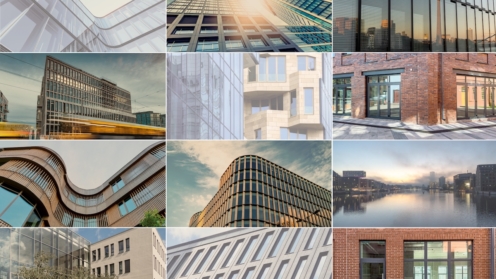Die Gewinnwarnungen von Porsche und deren Mehrheitseigner VW zeigen einmal mehr, wie schwierig sich der Strukturwandel in der Autoindustrie gestaltet. Die Branche kämpft gleichzeitig an mehreren Fronten. Zu nennen sind die mangelnde Akzeptanz der Elektromobilität in den meisten Industrieländern, die zunehmende Konkurrenz durch chinesische E-Auto-Hersteller, die restriktive US-Handelspolitik sowie die strenge EU-Regulierung.
Die globale Autoindustrie befindet sich in einer massiven Umbruchphase. Seit den Jahren 2016/17, als in Europa noch 17,5 Millionen PKW jährlich produziert wurden, sank diese Zahl auf rund 13 Millionen im Jahr 2022. Heute ist China der größte Autoproduzent und es verfügt auch über den volumen- und wachstumsstärksten Markt. Die chinesischen Autobauer drängen mit ihren günstigen E-Autos seit Jahren auch nach Europa. Seit 2019 ist die PKW-Herstellung im Euroraum um 19 Prozent zurückgegangen (Schätzung für 2025). Dabei hat sich Deutschland im europäischen Vergleich noch am besten geschlagen, hier beträgt das Minus „nur“ elf Prozent. Italien ist mit einem Einbruch von 63 Prozent das Schlusslicht, aber auch Großbritannien und Frankreich müssen einen Rückgang von über 40 Prozent verkraften. Besonders hart getroffen hat es die Zulieferindustrie.
Deutsche Hersteller können sich im Markt für E-Autos behaupten
Der deutschen Autoindustrie weht also rauer Wind entgegen, doch immerhin sind die hiesigen Hersteller mittlerweile an zweiter Stelle bei der Produktion von Elektroautos. Der Anteil der E-Auto-Produktion (inklusive Hybridantriebe) könnte 2025 auf 42 Prozent steigen, nach 33 Prozent im Vorjahr. Allerdings: Wachstum findet momentan fast nur noch in China statt. Dort herrscht aufgrund der Überproduktion der chinesischen E-Auto-Anbieter aber ein harter Preiskrieg. Die deutschen Marken verlieren seit Jahren Marktanteile. Deutsche Hersteller verkaufen in China weiterhin vor allem Fahrzeuge mit Verbrenner-Motoren, ihre E-Autos sind dort nicht wettbewerbsfähig. In Nordamerika und Europa haben deutsche Marken inzwischen sogar einen höheren Marktanteil im Elektro-Segment als im Gesamtmarkt. Die Situation in den USA ist aber generell angespannt, da sich das Land mit seiner Zoll- und Handelspolitik abschottet. Und der europäische Markt stagniert.
Die jüngste Gewinnwarnung von Porsche zeigt einmal mehr, wie der Strukturwandel den traditionellen Autobauern zusetzt. Porsche hatte geplant, bei bestimmten SUV-Baureihen nur noch vollelektrische Modelle anzubieten. Jetzt rudert das Unternehmen wieder zurück und will seine Autos sowohl mit Elektroantrieb als auch mit Verbrenner-Motor bauen. Die zweigleisige Strategie lässt die Kosten explodieren. Gleichzeitig enttäuscht der Absatz von Premium-E-Modellen in China. Das schwache Ergebnis von Porsche schlägt voll auf die Bilanz von VW durch. Dabei kämpft VW mit genug eigenen Problemen.
SDV (Software Defined Vehicle) – die Hoffnung einer ganzen Industrie
Auf der IAA (Internationale Automobilausstellung) in München, die vom 9. bis 14. September 2025 stattfand, stellten die deutschen Konzerne ihre neuen Elektroautos vor. BMW und Mercedes präsentierten elektrisch betriebene SUVs im höherpreisigen Segment. VW hingegen ist im Kleinwagen- und Kompaktbereich unterwegs und will im Herbst 2026 einen E-Polo und einen ID.Cross für die niedrigeren Preisklassen auf den Markt bringen. Diese SDVs, also die „Software Defined Vehicles“, sind nach unserem Eindruck technologisch (fast) auf Augenhöhe mit den chinesischen Anbietern, aber nach Kostenmaßstäben nicht.
Auf der IAA vor zwei Jahren sah es noch so aus, als ob der technologische Vorsprung der chinesischen E-Auto-Hersteller kaum noch einholbar sei. Hatten jene doch den Vorteil, dass sie ihre Entwicklung und Produktion – anders als die westlichen Traditionsmarken – praktisch ohne teure Altlasten im Maschinenpark oder Personalbestand von Null auf Hundert hochfahren konnten. Zudem wurden sie vom Staat hoch subventioniert und brachten ihre Autos damit deutlich unterhalb der tatsächlichen Produktionskosten unters Volk. Seitdem ist viel passiert, und wir beurteilen die Entwicklung überwiegend positiv: Die Europäer haben (zumindest teilweise) ihre Hausaufgaben gemacht. Der technologische Graben wurde größtenteils geschlossen. Die neuen Modelle von BMW und Mercedes setzen in ihren SDVs eine neuartige, kompakte und zentrale Computer-Architektur ein, die für den Betrieb eines SUVs nur noch maximal vier Supercomputer benötigt. Damit werden die Funktionalitäten zentral gebündelt, beispielsweise bei der Fahrassistenz, dem Batteriemanagement und dem Infotainment. Zudem können in Zukunft neu verfügbare Funktionen nachträglich per Funk (remote) auf die Software der Autos übertragen werden.
Chinesische E-Automarken wachsen in Europa, aber langsamer als befürchtet
Als die chinesischen Hersteller nach Europa kamen, war die Angst vor einer Marktschwemme mit billigen Elektroautos groß. Inzwischen lässt sich feststellen, dass die Chinesen Markanteile in Europa gewinnen, diese aber hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleiben. Bisher sind einige wenige Marken wie BYD und MG zwar stark gewachsen, aber die Volumina bleiben noch recht gering. In Deutschland etablieren sie sich erst langsam. Der Marktanteil der chinesischen Anbieter in Europa lag im zweiten Quartal 2025 bei fünf Prozent, in der EU bei 4,2 Prozent und in Deutschland bei etwa zwei Prozent.
Die chinesischen Anbieter verfügen zwar weiterhin über einen Produktionskostenvorteil, doch sind die staatlichen Subventionen mittlerweile weggefallen. Die chinesische Regierung hat die massive Subventionierung der Autobranche eingestellt, denn diese sorgte im Endeffekt für den Aufbau einer riesigen unprofitablen Industrie mit hohen Überkapazitäten und negativen Margen. Zudem manövrierten sich die Autohersteller auf ihrem Heimatmarkt in einen ruinösen Preiskampf, der auch die Deflation angefeuert hat. Diese Entwicklung soll nun gestoppt werden, wobei kleinere unprofitable Player komplett vom Markt verschwinden dürften. Die westlichen Hersteller können daher hoffen, dass ihre neuen Modelle auch in China wettbewerbsfähiger werden, wenn dort eine vernünftigere Preispolitik betrieben wird.
Die EU-Politik dürfte die strenge Regulierung zurücknehmen
Für die Autobranche ist der regulatorische Rahmen in der EU der Dreh- und Angelpunkt der weiteren Entwicklung. Bis zum Meilenstein im Jahr 2030, in dem 30 Millionen emissionsfreie Autos zugelassen sein sollen, und erst recht bis zur Null-Emissions-Regelung für Neuwagen ab 2035 ist es noch ein weiter Weg. Ab dem zweiten Quartal 2026 soll entschieden werden, ob es einen „Ausstieg vom Ausstieg“ aus dem Verbrenner geben soll und die Regeln wieder abgemildert werden. Probleme bereiten der E-Auto-Industrie die Abhängigkeit von Batterie-Importen aus China einerseits und die unzureichende Lade-Infrastruktur andererseits. Generell ist die Akzeptanz bei den Privatkunden noch zögerlich. Weitere Hemmnisse auf dem Weg zum Massenmarkt dürften die recht niedrigen Wiederverkaufswerte von E-Autos und die intransparenten Strompreise an den E-Ladestationen sein. Die deutsche Regierung und die EU haben die Nöte der Autoindustrie erkannt und planen, die Regulierung zu überarbeiten. Unter anderem steht hinter dem strengen Verbrenner-Verbot 2035 ein (wachsendes) Fragezeichen.
Bei Autoaktien ist weiterhin Vorsicht geboten
Angesichts dieser Herausforderungen stehen wir dem gesamten Sektor weiterhin vorsichtig gegenüber. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Neben dem strukturellen Wegbrechen des chinesischen Markts verlieren die meisten Hersteller auch Marktanteile in Europa sowie im Rest der Welt. Daraus resultiert starker Preisdruck. Hinzu kommen Belastungen durch die CO2-Reduktionsziele der EU. Die Profitabilität der Unternehmen ist von „Free Cash Flow positiv“ auf „Free Cash Flow negativ“ gekippt, gleichzeitig verfallen die Margen. Daher müssen bestehende Überkapazitäten bereinigt werden. Ab dem ersten Quartal 2026 sollten sich die Perspektiven aber wieder etwas aufhellen. Die Einführung neuer Modelle, mehr Planungssicherheit bei den US-Zöllen und ein nachlassender Preiskampf in China sorgen für mehr Zuversicht.
Autor: Moritz Kronenberger, Portfoliomanager bei Union Investment