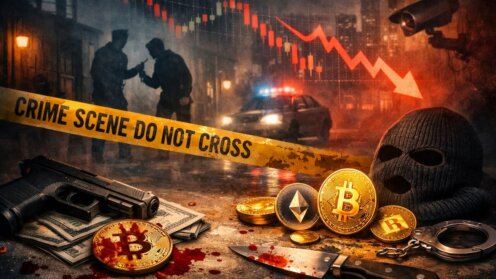Die Meldung über einen möglichen Produktionsstopp bei Volkswagen wegen fehlender Nexperia-Chips hat in der Industrie für Unruhe gesorgt. Was steckt aus Ihrer Sicht hinter diesem Vorgang?
Wiendieck: Im Kern ist das kein klassisches Lieferkettenproblem, sondern ein politisch induzierter Technologieschock. Nexperia ist zwar in den Niederlanden ansässig, steht aber unter chinesischer Kontrolle. Nachdem die niederländische Regierung auf Druck der USA die Kontrolle über das Unternehmen teilweise übernommen hat, reagierte Peking mit Exportbeschränkungen. Das zeigt, wie eng wirtschaftliche und politische Interessen inzwischen miteinander verwoben sind und wie schnell sich ein Handelskonflikt in einen faktischen Produktionsstillstand übersetzen kann.
Auf welcher Grundlage kann China solche Exportstopps verhängen, und wie berechenbar ist das für internationale Unternehmen?
Koppitz: Rechtsgrundlage ist vor allem das chinesische Exportkontrollgesetz, in Kraft seit Dezember 2020. Es wurde in den letzten Jahren mehrfach konkretisiert. Es erlaubt der Regierung, Exporte bestimmter Güter, Technologien oder Dienstleistungen zu untersagen, wenn nationale Sicherheitsinteressen betroffen sind. Hinzu kommen Spezialvorschriften etwa zu Halbleitern, seltenen Erden oder bestimmten Softwarekomponenten. Das Problem für Unternehmen liegt nicht selten in der vagen Terminologie: Die Kriterien, wann eine Technologie als „sensibel“ gilt, bleiben bewusst offen. Dadurch kann die Anwendung jederzeit politisch angepasst werden, was die Planungssicherheit erschwert.
Das heißt, Exportkontrolle ist in China inzwischen ein strategisches Steuerungsinstrument. Wie bewerten Sie das aus unternehmerischer Perspektive?
Wiendieck: Exportkontrolle ist in China Teil einer industriepolitischen Gesamtstrategie. Das Land will technologische Abhängigkeiten umkehren und zugleich sicherstellen, dass kritische Wertschöpfungsschritte im Inland bleiben. Hinzu kommt noch das kritische Verhältnis zur USA. Ein gutes Beispiel für den Versuch, autarker zu werden, ist der gerade verabschiedete, zum 1. Januar 2026 in Kraft tretende Standard für „inländische Produkte“. Hier gewährt China einen 20 % Preisbewertungsrabatt im öffentlichen Beschaffungswesen, wenn die Produkte die Voraussetzungen als „inländisch“ erfüllen.
Zurück zu den Ausfuhren aus China: Für deutsche und europäische Unternehmen bedeutet das, dass sie künftig stärker mit der Möglichkeit rechnen müssen, dass einzelne Bauteile oder Technologien plötzlich nicht mehr exportiert oder geliefert werden dürfen. Das betrifft nicht nur Chips, sondern potenziell z.B. auch Batteriematerialien, Spezialmaschinen oder Softwaretools. Unternehmen müssen solche Szenarien künftig in ihre Risikoplanung integrieren.
Was raten Sie deutschen Unternehmen, die in dieser Gemengelage weiterhin auf China als Lieferant oder Produktionsstandort setzen wollen?
Koppitz: Zunächst sollte die Supply Chain auf mögliche Anfälligkeiten und Schwachstellen analysiert werden. Hierauf basierend sollte dann diversifiziert werden, etwa durch Zweitlieferanten in Drittstaaten. Und nicht zuletzt müssen interne Compliance-Systeme auf Exportkontrollverstöße überprüft werden, auch in der Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern.
Wichtig ist zudem eine juristische und vertragliche Resilienzprüfung. Unternehmen sollten ihre Lieferverträge daraufhin analysieren, wie sie auf Exportverbote oder behördliche Eingriffe reagieren können. Klassische Force-Majeure-Klauseln reichen oft nicht aus. Man braucht präzisere Regelungen zu Lieferhindernissen durch staatliche Maßnahmen, einschließlich Informations- und Mitteilungspflichten. Auch die Sanktionskontrolle ist mitzudenken.
Rödl & Partner begleitet viele gerade mittelständische Industrieunternehmen operativ in China. Wie gehen diese aktuell mit solchen geopolitischen Risiken um?
Wiendieck: Die Sensibilität ist deutlich gestiegen. Viele Unternehmen arbeiten inzwischen mit sogenannten „China+1“-Strategien, also der Kombination aus lokaler Präsenz in China und ergänzenden Kapazitäten in anderen asiatischen Ländern. Hier hilft die Präsenz von Rödl & Partner in allen relevanten Märkten.
Gleichzeitig wollen die KMUs aber nicht aus China heraus, sondern sich innerhalb des Marktes anpassen, etwa durch lokale F&E oder eigene Joint Ventures, um den Zugang zu Technologie und Know-how zu sichern. Stichworte hier sind „China for China“ oder auch „Lokalisierung 3.0“. Wir sehen also weniger Rückzug, sondern eher eine Neuausrichtung, die rechtlich wie betriebswirtschaftlich klug abgesichert sein muss.
Der Fall Volkswagen betrifft nun ein Paradebeispiel deutscher Industrie. Welche Lehren sollten andere Branchen daraus ziehen?
Koppitz: Die wichtigste Lehre ist: Geopolitische Compliance ist Teil des Kerngeschäfts geworden. Wer heute in globalen Lieferketten agiert, muss nicht nur technische, sondern auch rechtliche und politische Risiken managen können. Unternehmen sollten frühzeitig Szenarien durchspielen: was passiert, wenn ein Zulieferer plötzlich nicht mehr liefern darf oder ein bestimmtes Teil als „kritisch“ eingestuft wird. Diese Risikovorsorge muss auch mit Chefsache sein, nicht bloß Aufgabe der Rechtsabteilung.
Und abschließend: was bedeutet das alles für die langfristige Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China?
Wiendieck: Ich sehe keine Abkehr, sondern eine Neujustierung. Die wirtschaftliche Verflechtung bleibt enorm, aber sie wird künftig stärker von rechtlichen Rahmenbedingungen geprägt sein. Europäische Unternehmen sollten China nicht meiden, aber sie müssen das Land realistischer einschätzen. Als Partner, Markt, aber immer zugleich auch als Regulierungsakteur mit eigener Agenda. Besonders spannend wird hier der neue 5-Jahresplan sein. Wir erwarten hier durchaus auch Chancen für europäische Unternehmen, gerade im Bereich moderner Fertigung, Industrie-Automatisierung, Robotik, Künstlicher Intelligenz, und vor allem auch bei der grünen Transformation. Weitere spannende Branchen werden u.a. auch sein: Luft- und Raumfahrt, Transport/Verkehr, Biotechnologie, der medizinische Sektor, sowie Qualitätsmesstechnik. Wer dies versteht und sich entsprechend aufstellt, kann auch in einem geopolitisch komplexeren Umfeld erfolgreich bleiben.