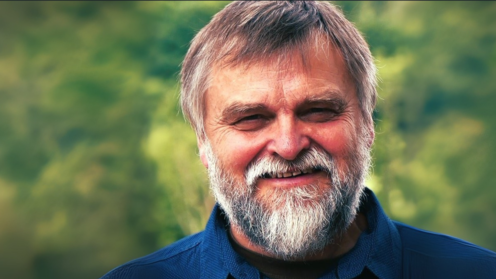Was erleben Sie aktuell bei den Versicherern? Sind die meisten schon auf dem richtigen Weg oder gibt es noch viele, die zögerlich in der Umsetzung sind?
Jaffke: Es gibt noch immer viele Versicherer, die im klassischen Produktverkauf verharren. Das zeigt sich auf Veranstaltungen, wenn Hochrechnungen präsentiert werden und die eigene Gesellschaft in den Charts oben steht – das ist die alte Welt. Viel wichtiger wäre es, die Mechanik der Produkte transparent zu machen und zu zeigen, wie sie sich in verschiedenen Marktsituationen verhalten. Eine Sechs-Prozent-Hochrechnung sagt wenig über die Qualität aus. Entscheidend ist, wie stabil ein Produkt in Krisen wie geopolitischen Konflikten oder wirtschaftlicher Unsicherheit bleibt. Am Ende muss der Kunde sich auch Jahre später mit seiner Entscheidung wohlfühlen.
Wo sehen Sie die größten Unsicherheiten bei den Vermittlern – eher bei Prognoserechnungen oder bei der Einhaltung von Zielmarktvorgaben?
Jaffke: Beim Thema Prognoserechnung haben sich nur wenige Vermittler ernsthaft mit dem Unterschied zwischen deterministischen und stochastischen Verfahren befasst. Viele zweifeln zwar an, ob neun Prozent Rendite seriös sind, pendeln sich dann aber bei drei bis sechs Prozent ein, ohne die Grundlagen zu prüfen. Doch lineare Hochrechnungen sind nicht realistisch. Bei den Zielmarktvorgaben ist die Lage etwas besser: Versicherer und Vergleichsrechner bieten Unterstützung, sodass Kundenprofile meist zuverlässig bestimmt werden. Trotzdem gilt: Ohne Verständnis der Produktmechanik reicht eine rein technische Quote nicht aus.
Wo hakt es denn konkret beim Thema Prognoserechnung?
Jaffke: Es ist ein Stück weit die geübte Praxis. Unabhängig vom Produkt wird einfach ein Zinssatz unterstellt, eine Hochrechnung erstellt und dem Kunden wird eine Ablaufleistung oder Rente präsentiert. Das ist schnell erklärt. Wir haben in unserer Angebotssoftware natürlich auch dieseklassische Darstellung nach der Brutto- oder Nettomethode. Zusätzlich bieten wir aber mit unserem Volatium-Modell eine stochastische Hochrechnung. Schaut man sich die Ergebnisse an, ist das deutlich komplexer als die bekannte 3-6-9-Prozent-Prognose. Wenn ein Berater diese Methode in die Beratung integriert, eröffnet das Mehrwerte. Kunden stellen Fragen, wollen die Mechanismen verstehen – und genau hier kann sich der Vermittler positiv abheben. Voraussetzung ist aber, dass er sattelfest in diesen Themen ist. Ansonsten wirkt es eher kontraproduktiv. Wir müssen als Branche noch daran arbeiten, diesen anspruchsvolleren Weg stärker zu etablieren. Denn die Stochastik liefert allen Beteiligten einen klaren Mehrwert. Nur ist sie eben nicht so trivial anzuwenden wie die einfache Prozentrechnung, wobei ihre Aussage genauso leicht verständlich ist.
Die BaFin fordert inzwischen quantitative Produktinformationen auf Basis stochastischer Simulationen. Sie haben es eben schon angedeutet: Klassische Hochrechnungen reichen bei Fondspolicen also definitiv nicht mehr aus?
Jaffke: Korrekt. Hier ist die Stochastik die einzige sinnvolle Antwort, weil sie die unterschiedlichen Marktszenarien realistisch abbildet. Wir unterziehen Produkte zum Beispiel 10.000 verschiedenen Kapitalmarktpfaden und sehen uns an, wie sie jeweils reagieren. Zudem berücksichtigen wir auch, dass ein Teil der monatlichen Beiträge nicht in der freien Fondsanlage steckt, sondern im Sicherungsvermögen – mit ganz anderer Verzinsung. Bei deterministischen Hochrechnungen entstehen dadurch häufig unplausible Ergebnisse. In einer gemeinsamen Studie mit der Alten Leipziger konnten wir zeigen, dass Produkte mit Garantie teilweise höhere Gesamtverzinsungen auswiesen als Produkte ohne Garantie. Das entspricht natürlich nicht der Realität. Genau deshalb sind klassische lineare Hochrechnungen hier nicht mehr tragfähig.
Blicken wir auf nachhaltige Produkte. Wie lässt sich der Kundennutzen hier bewerten? Denn die Attraktivität hängt ja nicht nur von Renditekennzahlen ab.
Jaffke: Bei nachhaltigen Produkten ist entscheidend, die Haltung des Kunden zu klären. Ein breiter Kapitalmarktansatz eröffnet Renditechancen – oft auch in Branchen, die aus ESG-Sicht kritisch sind, wie aktuell die Rüstungsindustrie. Diese Werte profitieren von geopolitischer Nachfrage, liefern Rendite, stehen aber im Widerspruch zu strengen Nachhaltigkeitskriterien. Die zentrale Frage lautet: Ist der Kunde bereit, auf solche Chancen zu verzichten? Studien zeigen, dass die Toleranz für Renditeeinbußen meist gering ist. Deshalb muss der Vermittler das Thema offen ansprechen und Erwartungen abgleichen. Wer Nachhaltigkeit priorisiert, sollte konsequent entsprechend beraten werden. Gleichzeitig darf ESG nicht das alleinige Qualitätskriterium sein – renditeorientierte Anleger haben andere Bedürfnisse. Ergänzend lohnt der Blick auf ESG-Berichte der Versicherer, um die Kapitalanlage im Sicherungsvermögen einschätzen zu können. Entscheidend bleibt: Kunden müssen wissen, worauf sie sich einlassen – und Beratung muss ihre Präferenzen konsequent berücksichtigen.
Kann Value for Money auch zur Qualitätsprüfung nachhaltiger Altersvorsorgeprodukte beitragen?
Jaffke: Auf jeden Fall. Value for Money schärft generell den Blick auf Produkte und den konkreten Kundennutzen. Für Anleger, denen Nachhaltigkeit besonders wichtig ist, wird dieser Aspekt dadurch automatisch stärker in den Fokus gerückt. Die Frage lautet dann: Welche Rolle spielt ESG für den einzelnen Kunden und wie relevant ist es für seine persönliche Vorsorgestrategie? Dieser Ansatz kann der Integration von Nachhaltigkeit einen zusätzlichen Schub geben, weil er konsequent auf die Bedürfnisse des Kunden abstellt.
Kommen wir zum Volatium-Modell. Wie unterstützt morgen & morgen mit diesem Modell die Nutzenanalyse von Altersvorsorgeprodukten – und wie ist es regulatorisch anerkannt?
Jaffke: Unser Volatium-Modell gibt es seit rund 15 Jahren, inzwischen in Version 4.0. Wir passen es regelmäßig an die aktuellen Marktgegebenheiten an. Viele Versicherer setzen es bereits erfolgreich in ihren Produktfreigabeverfahren ein. Im Austausch mit der BaFin wird das Modell dabei ganz selbstverständlich berücksichtigt. Uns sind keine Fälle bekannt, in denen es Probleme gegeben hätte.. Das zeigt, dass wir mit Volatium sehr gut aufgestellt sind und Versicherer kompetent unterstützen können.
Steigt das Interesse am Modell, seit die BaFin strengere Kriterien anlegt?
Jaffke: Definitiv. Wir pflegen ohnehin schon seit vielen Jahren enge Partnerschaften, aber in den vergangenen Monaten sind neue Kooperationen hinzugekommen, bestehende wurden ausgeweitet. Besonders in der betrieblichen Altersversorgung spüren wir eine deutlich stärkere Nachfrage. Dort fragen Kunden und Vermittler gezielt nach belastbaren Analysen – und die Versicherer greifen das auf, nicht zuletzt, weil sie wissen, welche Anforderungen die BaFin stellt.
Blicken wir auf die Produktstrategien der Versicherer. Welche Potenziale sehen Sie in den kommenden Jahren – etwa für die bAV oder Hybridprodukte? Und welche Rolle könnte Künstliche Intelligenz dabei spielen?
Jaffke: Das Produktgenehmigungsverfahren kann ein Treiber für Innovation sein. Künftig müssen Policen stärker an Kundennutzen, Marktszenarien und regulatorische Vorgaben ausgerichtet werden. Das erfordert mehr Flexibilität bei Ein- und Auszahlungen, Anlageschwerpunkten und Handlungsoptionen. Die größte Herausforderung liegt in der IT: Hochflexible Produkte müssen in Bestandsführung und Kostenstruktur sauber abgebildet werden. Zudem muss die IT sicherstellen, dass regulatorische Anforderungen der BaFin dauerhaft überwacht und eingehalten werden. Nur wenn Produktentwicklung, Governance und IT eng verzahnt sind, lassen sich die Versprechen langfristig zuverlässig erfüllen.
Die BaFin hat ja bei einigen Versicherern schon auf Defizite hingewiesen, gerade bei der IT. Auch aus Gesprächen weiß ich, dass viele Häuser hier noch erheblichen Nachbesserungsbedarf haben.
Jaffke: Definitiv. Entscheidend ist, dass Produktinnovation am Point of Sale im Gleichklang mit der Verwaltung dieser Verträge steht. Hinzu kommt: Auch die Vermittler müssen von den Versicherern mitgenommen werden. Denn die erweiterten Pflichten, die Versicherer jetzt tragen, wirken sich unmittelbar auf die Beratung aus. Vermittler müssen komplexere Produkte verstehen und erklären können. Externe Simulationsmodelle können dabei helfen, Produktinnovationen zu fördern und Kunden klarer zu zeigen, wie sich Verträge in unterschiedlichen Marktszenarien entwickeln.
Ihre Prognose: Werden Value-for-Money-Kriterien mittelfristig zum echten Marktstandard?
Jaffke: Ich gehe eher von einer kurzfristigen Umsetzung aus. Die BaFin verfolgt den Value for Money Ansatz sehr konsequent. Von internen Prüfungen etlicher Versicherer bis hin zu aktuellen „Mysterie-Shopping-Aktivitäten“. Es wäre von Vorteil, wenn die Branche den Ansatz als strategische Chance begreift und ihm proaktiv begegnet. Im Sinne einer Altersvorsorge, die Vertrauen weckt und Nutzen stiftet.
Wie sieht es bei klassischen Produkten aus?
Jaffke: Solange sich mit klassischen Policen noch Rendite erzielen lässt, werden sie ihre Relevanz behalten. Der deutsche Anleger hat ein starkes Bedürfnis nach Garantien. Ein Beispiel ist die Riester-Rente: Durch die Anpassung des Rechnungszinses können wieder mehr Versicherer die geforderte 100-Prozent-Garantie darstellen – und einige, die Riester schon aufgegeben hatten, sind wieder in den Markt eingestiegen. Das zeigt, dass Nachfrage vorhanden ist. Wenn der Kapitalmarkt hergibt, dass sich auch mit klassischen Produkten eine nennenswerte Rendite erwirtschaften lässt, werden diese Produkte nicht verschwinden. Würden wir irgendwann wieder Zinsniveaus wie in den 80er- oder 90er-Jahren sehen, ließe sich eine Garantiepolice mit fünf oder sechs Prozent Verzinsung sicher verkaufen.
Was raten Sie Versicherern und Vermittlern, die den Wandel als Chance begreifen wollen?
Jaffke: Wichtig ist, die Chance zur klaren Positionierung zu nutzen. Versicherer können sich durch Vermittlerunterstützung und ein belastbares Produktportfolio vom Wettbewerb abheben. Wer konsequent auf Value for Money setzt und mit simulationsbasierten Modellen die Wirksamkeit belegt, schafft Marktchancen – mit mehr Abschlüssen und höherer Bestandssicherheit. Präzise definierte Zielmärkte und klarer Kundennutzen führen zu geringeren Stornoquoten und stabileren Kundenbeziehungen. Einige Anbieter zeigen bereits, wie sich so Marktanteile gewinnen lassen. Der reine Produktverkauf verliert an Bedeutung – künftig zählt, komplexe Produkte verständlich zu erklären und Beratungskompetenz sichtbar zu machen.
Das Interview führte Jörg Droste, Ressortleiter Versicherungen Cash. & Cash.online