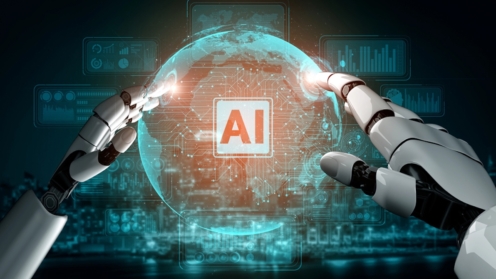Jahrzehntelang galten Staatsanleihen als Inbegriff der Sicherheit. Wer konservativ investieren wollte, kaufte Bundesanleihen, Treasuries oder andere „risikolose“ Titel. Doch diese Gewissheit bröckelt. Die Rahmenbedingungen haben sich dramatisch verschoben. Die westlichen Staaten sind bis zur Halskrause verschuldet, die Notenbanken stecken im Dilemma zwischen Preisstabilität und Staatsfinanzierung und die Zinsen müssen – aus fiskalischer Sicht – eigentlich niedrig bleiben. Doch was bedeutet das für Anleger?
Zinsen runter, Inflation rauf – und wer zahlt die Rechnung?
Ein Blick auf die Schuldenlast macht die Richtung deutlich: Die USA haben die 120-Prozent-Marke der Staatsschulden in Relation zum BIP längst überschritten, die Länder der Eurozone nähern sich ebenfalls kritischen Schwellen. In einem solchen Umfeld ist eines klar: Hohe Zinsen sind auf Dauer für die Staaten nicht tragbar. Die Folge? Notenbanken greifen ein. Die australische Notenbank, genauso wie die japanische Notenbank haben bereits mit „Yield Curve Control“ experimentiert – einem Instrument, bei dem die langfristigen Zinsen durch Anleihenkäufe künstlich gedrückt werden. Was dabei herauskommt, ist eine finanzielle Repression. Anleger erhalten dann niedrige Zinsen, während die Inflation ihre Kaufkraft still und leise aufzehrt.
Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert aktuell mit rund 2,6 Prozent. Bei einer „offiziellen“ Inflationsrate von etwa 2,4 Prozent bleibt kaum realer Ertrag übrig. Das gilt als „konservativ“. Aber was ist konservativ an einem Investment, bei dem der reale Kaufkrafterhalt fraglich ist und man sich nicht sicher sein kann, welche Währung es zum Rückzahlungszeitpunkt in zehn Jahren überhaupt noch gibt?
Wer Aktien hält, besitzt Anteile an der Substanz
Im Gegensatz zur Anleihe, die ein Rückzahlungsversprechen eines verschuldeten Staates oder Unternehmens in immer schwächer werdenden Währungen darstellt, ist eine Aktie ein Anteil an einem Unternehmen, also an einem Sachwert. Wenn dieses Unternehmen auch noch stabile Erträge, robuste Geschäftsmodelle und geringe Verschuldung mitbringt, wird aus einer Aktie ein echter Wertspeicher.
Aber es können nicht nur der Unternehmenswert und damit der Preis der Aktie langfristig steigen und gegenüber dem Rückzahlungsbetrag einer Anleihe die Inflation mehr als ausgleichen. Es gibt zusätzlich auch noch Aktien mit Dividendenzahlungen, deren Renditen mit dem Anleihezins durchaus mithalten können. Europäische Qualitätsunternehmen mit stabilen Ausschüttungen lieferten in den letzten Jahren meist Dividendenrenditen zwischen drei und vier Prozent.
Diese Ausschüttungen sind nicht nur laufende Erträge, sondern können – anders als Zinsen – mit der Inflation steigen. Gute Dividendenzahler passen ihre Dividenden regelmäßig an, gerade wenn Umsatz und Cashflow wachsen. Damit bieten sie Schutz, wo Anleihen nur festgeschriebenen Nominalwert liefern.
Der zweite Weltkrieg – und was heute daraus zu lernen ist
Historisch zeigt sich die Stärke von Aktien und anderen Sachwerten auch in Extremphasen: Wer vor oder während des Zweiten Weltkriegs in deutsche Staatsanleihen investiert hatte, stand später mit wertlosen Reichsmarkpapieren da. Wer hingegen eine Mischung aus deutschen Aktien oder gar Anteile an globalen Unternehmen hielt, besaß Substanz, die den Systembruch überstand.
Zugegeben, Dividendenaktien schwanken durchschnittlich mehr als Anleihen. Aber das Jahr 2022 hat gezeigt, dass auch Staatsanleihen keineswegs stabil sind – als die Zinsen anzogen, fielen viele Anleihekurse so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Volatilität von Anleihen war plötzlich mit der von Aktien vergleichbar – nur bei deutlich geringerem Ertragspotenzial.
Es ist Zeit, „konservativ“ neu zu denken
Vor dem Hintergrund anhaltender Inflation und struktureller Geldentwertung stellt sich für langfristig orientierte Anleger die zentrale Frage: Können Anleihen überhaupt noch ihre klassische Rolle als konservative Kapitalanlage erfüllen? Die Realität sieht ernüchternd aus. Selbst bei nominal attraktiven Zinssätzen bleibt nach Abzug der Inflation kaum reale Rendite übrig – und das Risiko ist längst nicht mehr so gering, wie es das Etikett „sicher“ vermuten lässt. Zahlungsausfälle von Staaten sind historisch keineswegs selten. Man denke an Griechenland, Argentinien oder andere Schuldenschnitte. Auch in etablierten Währungsräumen wie der Eurozone lassen sich solche Szenarien in Zukunft nicht ausschließen.
Dem gegenüber steht ein global breit gestreutes Portfolio von Qualitätsaktien – Unternehmen mit soliden Bilanzen, robusten Geschäftsmodellen, historisch verlässlichen Dividenden und internationaler Marktstellung. Dass alle diese Firmen gleichzeitig scheitern, ist nahezu ausgeschlossen.
Die sichere Geldanlage beginnt im Kopf
Ja, solche Aktien schwanken stärker im Kurs. Aber wenn man das Risikoverständnis vor dem Hintergrund der strukturellen Probleme neu definieren will und wahrscheinlich muss – weg von kurzfristiger Volatilität hin zu langfristigem Werterhalt – dann wird klar: Es kann konservativer sein, mit temporär größeren Schwankungen zu leben, als in nominal „sichere Geldwerte“ zu investieren, deren reale Kaufkraft systematisch schwindet.
Und wenn sich diese Sichtweise im kollektiven Anlegerbewusstsein durchsetzt, könnten genau diese Aktiensegmente in den kommenden Jahren und Jahrzehnten stark gefragt und damit sehr stabil sein – die Frage der fairen Bewertung könnte dann neu interpretiert werden. Das Spannende daran ist sogar, dass viele dieser Titel im historischen Vergleich noch nicht teuer sind, insbesondere im Value-Segment. Wer jetzt umdenkt, denkt meiner Meinung nach nicht nur konservativ – sondern auch vorausschauend.
Tim Bröning ist Mitglied des Beirats bei Fonds Finanz.