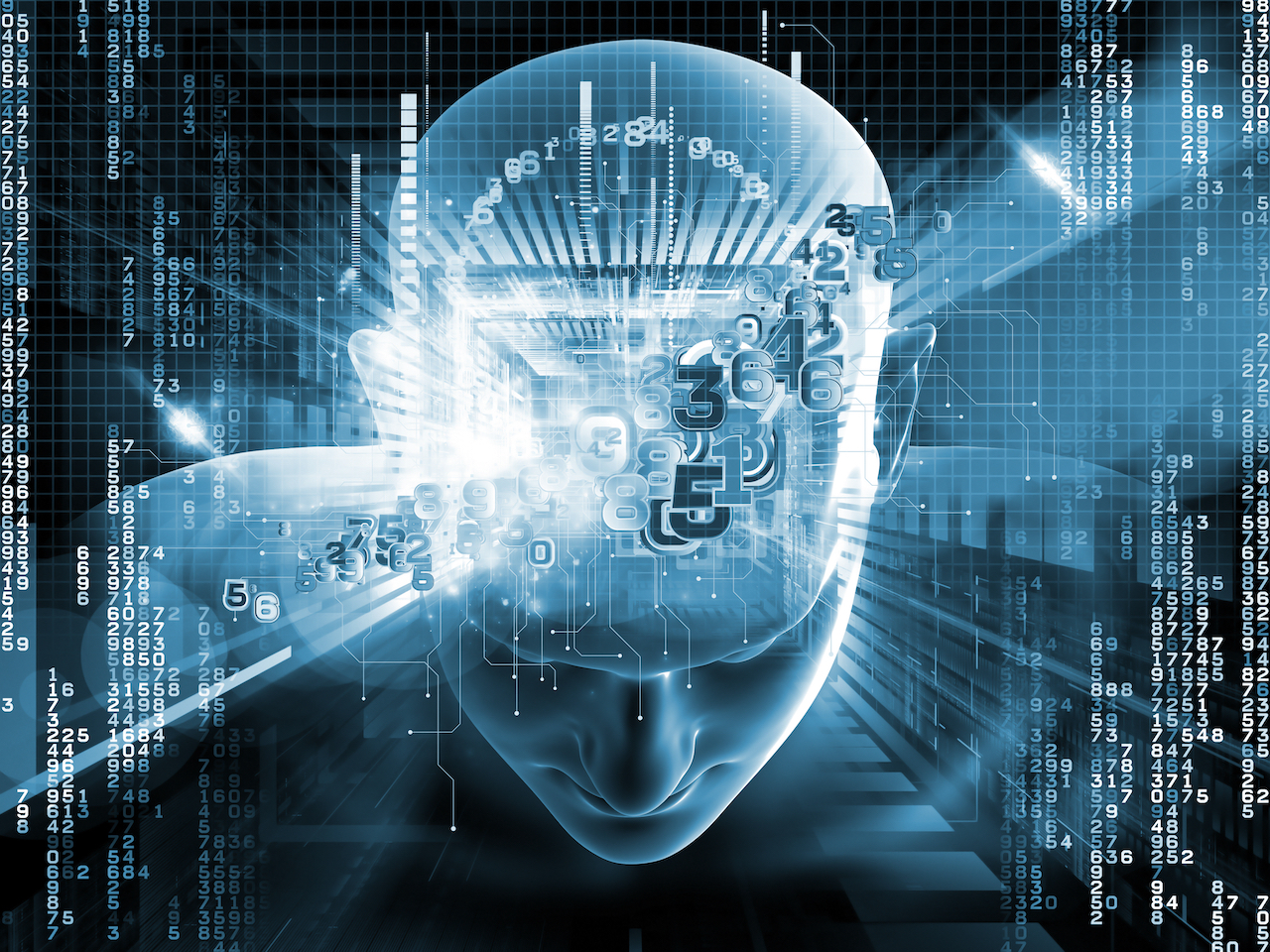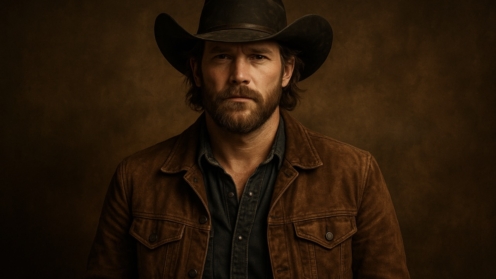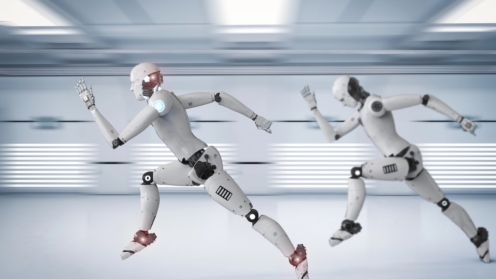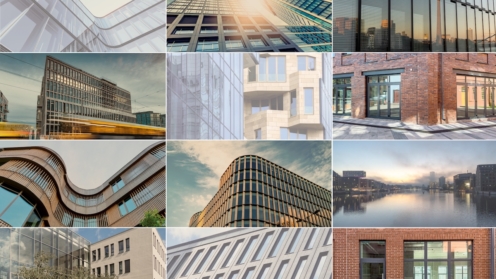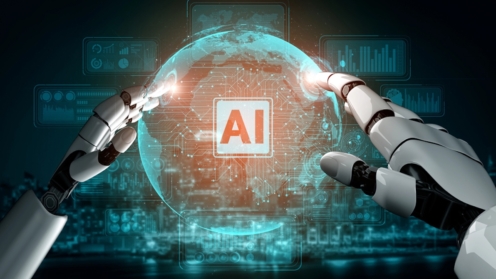In den USA ist eine Rezession unwahrscheinlich. Die Notenbank muss jedoch den Spagat zwischen konjunktureller Abkühlung und hartnäckiger Inflation meistern. Und mit Blick auf die steigende Schuldenquote verlassen sich die Finanzmärkte darauf, dass die Notenbank im Notfall als Lender of Last Resort bereitsteht. Europa und insbesondere Deutschland lassen sich 2026 wieder mit mehr Konjunkturoptimismus betrachten, Reformen sind allerdings weiterhin dringend nötig. Sorgen macht Frankreichs wachsender Schuldenberg. Aber auch hier beruhigt offenkundig die Hoffnung auf die Europäische Zentralbank als Retter in der Not die Märkte.
Die Weltwirtschaft trotzt dem aktuellen politischen Umfeld und wächst. Das Wachstum kommt vor allem aus den Schwellenländern. Aber auch die US-Wirtschaft leistet ihren Beitrag. „Wir sehen keinen konjunkturellen Absturz, sondern nur eine Abkühlung. 2025 dürfte die US-Wirtschaft um etwa 1,8 Prozent wachsen, was leicht unter dem bisherigen Potenzialwachstum liegt“, sagt Jörn Quitzau, Chefökonom bei der Schweizer Privatbank Bergos. In der Eurozone sind die ehemaligen Krisenländer wie Spanien, Griechenland und Zypern die Wachstumstreiber, die großen Volkswirtschaften Frankreich und Deutschland eher Sorgenkinder.
Das Inflationsumfeld ist sehr differenziert. In der Schweiz befindet sich die Teuerungsrate seit über zwei Jahren im angestrebten Korridor zwischen 0 und 2 Prozent. In der Eurozone liegt sie nur noch leicht über dem 2-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), was der EZB ein komfortables Umfeld ohne Zugzwang beschwert. In Großbritannien hingegen liegt die Inflation mit 3,8 Prozent deutlich über der Zielmarke. Auch in den USA ist sie mit etwa 3 Prozent hartnäckig hoch. Zudem sind die noch ausstehenden Zolleffekte ein Unsicherheitsfaktor. Insbesondere die US-Notenbank Fed mit ihrem dualen Mandat ist in einer schwierigen Lage. Einerseits muss sie die Preise stabil halten, und dafür ist die Inflation derzeit zu hoch. Andererseits muss sie für maximale Beschäftigung sorgen, während die konjunkturelle Abkühlung den Arbeitsmarkt erreicht. Hinzu kommt politischer Druck.
„Während in Großbritannien die Chance besteht, dass die Inflation sich 2026 der 2-Prozent-Marke nähert, müssen wir uns in den USA weiter auf höhere Inflationsraten einstellen“, prognostiziert Quitzau, der künftig eine gewisse Inflationstoleranz bei der Fed und anderen Zentralbanken erwartet. Auch Raten von 2,5 oder 3 Prozent werden dann akzeptiert. Grund sind mehrere Faktoren wie Demografie, Deglobalisierung und in Europa die zunehmende Bepreisung der CO2-Emissionen, die mittelfristig höhere Inflationsraten nicht nur in den USA erwarten lassen. Zudem werden die Zentralbanken aufgrund der hohen Staatsverschuldung ihre Geldpolitik wahrscheinlich lockerer gestalten müssen, als ihnen lieb ist, um größeren Schaden abzuwenden. Ein Nebeneffekt sind höhere Inflationsraten.
USA: Rezessionsgefahr gering, wachsender Schuldenberg
In den USA dürfte eine Rezession ausbleiben. Die Finanzpolitik bleibt sehr expansiv, und die Geldpolitik wird expansiver. Das sollte zur Stabilisierung der Wirtschaft beitragen. „Schädlich hingegen ist die Sprunghaftigkeit der amerikanischen Politik. Bislang sind die negativen Auswirkungen kaum in den Wirtschaftsdaten erkennbar, aber zerstörtes Vertrauen wirkt eher mittel- bis langfristig“, so Quitzau. Mit einer Ablösung des US-Dollar als Leitwährung, wie sie von einigen befürchtet wird, rechnet er allerdings nicht. Der Grund ist simpel: Es gibt keine guten Alternativen.
Ein Risiko birgt der durch die Politik des US-Präsidenten weiter steigende Schuldenberg. Der Internationale Währungsfonds erwartet für die nächsten Jahre ein Haushaltsdefizit für die USA von um die 8 Prozent. Das führt dazu, dass die Staatsschulden von 122 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2030 auf rund 144 Prozent steigen. „Das ist ein horrender Schuldenstand. Wahrscheinlich werden die Finanzmärkte nicht das gesamte Kapital für die Neuverschuldung zu moderaten Zinsen bereitstellen. Aber dann wird die Fed als Käufer einspringen. Die hohe Verschuldung dürfte also vorerst nicht dazu führen, dass von den USA eine große Finanzkrise ausbricht“, meint Quitzau.
Europa: Frankreich versinkt in Schulden, Deutschland kehrt zurück auf den Wachstumspfad
In Europa ist Frankreich derzeit das Schulden-Sorgenkind, hinzu kommen Konjunkturprobleme. Die Staatsverschuldung liegt mittlerweile bei über 110 Prozent. Das politische Umfeld macht es jedoch schwierig, Sparprogramme und andere Maßnahmen umzusetzen, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die Staatsfinanzen stabilisieren. „Da sich die politische Gemengelage so schnell nicht verändern wird, besteht die Gefahr, dass die Finanzmarktakteure irgendwann die Geduld verlieren und mehr Zinsen für ihr Kapital haben wollen. Dann käme die Schuldenspirale in Gang“, sagt Quitzau.
Bislang sind die Märkte noch sehr ruhig. Das kann trügerisch sein, ist aber auch verständlich. Denn es ist anzunehmen, dass die Eurozone Frankreich in einer brenzligen Situation nicht allein lassen würde. „Damit bestimmte Instrumente genutzt werden können, werden jedoch Konditionen vorausgesetzt, die Frankreich nicht erfüllt. Aber auch wenn die EZB eigentlich nicht helfen dürfte, würde sie es wahrscheinlich dennoch auf irgendeine Art und Weise tun. Letztlich würde wohl ein Bailout einen Kollaps Frankreichs und einen drohenden Flächenbrand vermeiden“, sagt Quitzau.
Deutschland hat bislang kein Schuldenproblem, und konjunkturell ist Erholung in Sicht.Trotz wachsender Bevölkerung stagnierte die Wirtschaftsleistung preisbereinigt über die vergangenen fünf Jahre. „Für 2026 erwarten wir ein Wachstum von rund ein Prozent“, sagt Quitzau. Hohe Staatsausgaben liefern einen zusätzlichen fiskalischen Impuls, der 2026 und 2027 wirken wird. „Dann müssen aber weitere wachstumsfördernde Reformen greifen, die jetzt im ‚Herbst der Reformen‘ angegangen werden müssen, etwa zur Rentenpolitik und zum Bürokratieabbau. Zudem muss nicht nur in Deutschland, sondern in Europa allgemein wieder verstanden werden, dass Wirtschaftswachstum zu Fortschritt führt und die Gesellschaft nach vorn bringt. Durch Verzicht und ohne Wachstum werden wir die Wirtschaft und die Gesellschaft nicht flottkriegen und im internationalen Wettbewerb weiter zurückfallen“, mahnt Quitzau.
Als Wachstumsjoker für Deutschland und andere Länder kann sich die Künstliche Intelligenzerweisen. Durch KI sind in einzelnen Bereichen der Wirtschaft massive Produktivitätssteigerungen möglich. Sie könnte für einen erheblichen Wachstumsschub sorgen, unabhängig von wirtschaftspolitischen Reformen. Dadurch könnten viele Probleme gelöst werden inklusive der steigenden Staatsschulden, die durch höheres Wachstum relativiert werden.