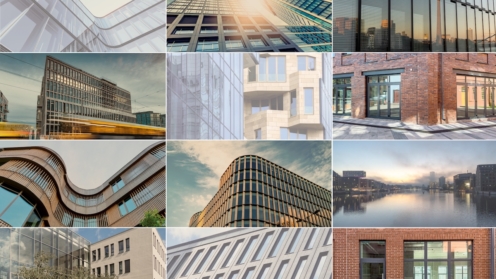Es ist eine Behauptung, die in der öffentlichen Debatte immer wieder hochgekocht wird: Milliardäre würden in Deutschland weniger Steuern zahlen als Angestellte. Ein Satz, der Schlagzeilen garantiert, sich in Talkshows gut anhört und in sozialen Medien hundertfach geteilt wird. Das Problem: Er stimmt nicht. Weder absolut noch prozentual.
Und trotzdem wird er gebetsmühlenartig wiederholt. Nicht, weil er den Fakten standhält, sondern weil er ein nützliches Werkzeug ist, um Neid zu schüren, die Gesellschaft zu spalten und populistische Steuerforderungen zu rechtfertigen. Genau diese Mischung aus Polemik und Halbwahrheiten sorgt dafür, dass wir in Deutschland mittlerweile Debatten führen, die nichts mehr mit Realität zu tun haben. Es ist höchste Zeit, die Zahlen sprechen zu lassen.
Wer in Deutschland als Arbeitnehmer Geld verdient, unterliegt einem progressiven Einkommensteuertarif. Ab einem Grundfreibetrag von rund 12.000 Euro steigt der Eingangssteuersatz von 14 Prozent linear an – bis er ab etwa 68.500 Euro beim Spitzensteuersatz von 42 Prozent liegt. Für Einkommen oberhalb von 277.826 Euro greift dann zusätzlich die sogenannte „Reichensteuer“ von 45 Prozent.
Wichtig: Das sind Grenzsteuersätze. Niemand zahlt auf sein gesamtes Einkommen 42 oder 45 Prozent. Wer 70.000 Euro verdient, zahlt auf die ersten knapp 12.000 Euro gar keine Steuer, auf den nächsten Abschnitt 14 Prozent, auf den nächsten etwas mehr – und so weiter. Erst jeder zusätzliche Euro über der jeweiligen Grenze wird mit dem höheren Satz belastet.
Hinzu kommen Solidaritätszuschlag (5,5 Prozent auf die Einkommensteuer, ab einer Freigrenze) und – für rund die Hälfte der Bevölkerung – Kirchensteuer (hier mit 8,5 Prozent angenommen). Außerdem werden vom Bruttoeinkommen Werbungskosten abgezogen: pauschal mindestens 1.230 Euro, realistisch bei mittleren bis höheren Einkommen oft eher 3.000 bis 4.500 Euro.
Was bei Kapitalgesellschaften passiert
Bei Unternehmen ist die Sache komplexer. Gewinne unterliegen zunächst der Körperschaftsteuer (15 Prozent plus Solidaritätszuschlag, effektiv 15,825 Prozent) und der Gewerbesteuer. Je nach Gemeinde variiert der Hebesatz, im bundesweiten Durchschnitt liegt er bei etwa 409 Prozent – was auf eine effektive Belastung von rund 14,35 Prozent hinausläuft. Zusammengerechnet ergibt das knapp über 30 Prozent Steuerlast auf Unternehmensebene.
Doch damit ist es nicht getan. Wird der Gewinn ausgeschüttet, greift die Kapitalertragsteuer von 25 Prozent, zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Erst was danach übrig bleibt, landet tatsächlich im privaten Portemonnaie des Unternehmers.
Das bedeutet: Auch bei Unternehmensgewinnen liegt die effektive Steuerbelastung schnell bei 50 Prozent – und eben nicht bei 25, wie oft behauptet wird.
Zahlen statt Parolen
Um den Mythos sauber zu prüfen, habe ich Modellrechnungen erstellt. Sie zeigen die Steuerlast für Arbeitnehmer in verschiedenen Einkommensstufen und für einen Milliardär, dessen Unternehmen 10 Millionen Euro Gewinn erzielt und vollständig ausschüttet.

Die Tabelle macht es glasklar:
- Der durchschnittliche Arbeitnehmer in Deutschland zahlt mit einem Bruttoeinkommen von 50.000 Euro knapp 23 Prozent Steuern.
- Erst bei einem Jahreseinkommen von > 500.000 Euro (circa 0,02 – 0,08 Prozent aller Steuerpflichtigen in Deutschland) nähert sich die Steuerquote eines Arbeitnehmers der eines Unternehmens an.
- Und ein Milliardär, dessen Firma 10 Millionen Gewinn erwirtschaftet und an ihn ausschüttet, wird genauso hoch belastet – mit rund 50 Prozent.
Die Behauptung, Milliardäre würden weniger Steuern zahlen als Angestellte, ist damit nicht nur falsch – sie ist eine gezielte Verdrehung der Realität. Sie funktioniert nur, wenn man so tut, als würden Unternehmensgewinne ohne Körperschaft- und Gewerbesteuer direkt als Dividende beim Unternehmer landen. Genau das ist aber schlicht nicht der Fall.
Sonderfall Kapitalmarktinvestor
Natürlich gibt es auch Milliardäre, die ihr Vermögen breit gestreut am Kapitalmarkt anlegen – etwa in Aktien oder ETFs. In diesem Fall werden ihre Erträge auf privater Ebene „nur“ mit der Abgeltungssteuer von 25 Prozent (plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) belastet. Doch auch diese Betrachtung greift zu kurz: Denn Dividenden stammen aus Unternehmensgewinnen, die zuvor bereits mit Körperschaft- und Gewerbesteuer besteuert wurden. Und anders als beim Angestelltengehalt trägt der Anleger zusätzlich das volle Marktrisiko – Kursverluste, Wertschwankungen und das Risiko des Totalverlusts bei Einzelinvestments.
Faktisch werden also auch Kapitalerträge doppelt belastet – auf Unternehmensebene und auf Anlegerebene. Wer behauptet, Milliardäre würden hier „nur 25 Prozent“ Steuern zahlen, blendet diese Realität bewusst aus.
Das Problem mit der Neiddebatte
Warum hält sich ein Mythos, der so leicht zu widerlegen ist? Weil er politisch nützlich ist. Wer Reiche pauschal als Steuerhinterzieher oder Schmarotzer darstellt, kann schnell Applaus einheimsen. Dass dabei Halbwahrheiten und Lügen im Spiel sind, spielt keine Rolle – die Erzählung ist wichtiger als die Fakten.
Doch diese Erzählung spaltet. Sie macht aus Leistungsträgern Sündenböcke und verschleiert das eigentliche Problem: Deutschland hat schon heute die zweithöchste Abgabenquote in der gesamten OECD. Wir nehmen so viel Geld ein wie nie zuvor – der Bundeshaushalt wird mit neuen Schulden und „Sondervermögen“ aufgebläht und trotzdem diskutieren wir über Steuererhöhungen. Nicht, weil zu wenig Geld da wäre, sondern weil es schlecht ausgegeben wird.
Fazit: Neid ist eine Todsünde – und eine politische Waffe
Die Fakten zeigen: Reiche zahlen in Deutschland nicht weniger, sondern genauso viel oder sogar mehr Steuern als Spitzenverdiener im Angestelltenverhältnis. Wer etwas anderes behauptet, lügt – oder plappert nach, was andere im politischen Aktivismus vorgeben.
Neid ist nicht ohne Grund eine Todsünde. Er zerstört Zusammenhalt und Vertrauen, er spaltet und vergiftet Debatten. Statt immer wieder neue Gräben aufzureißen, sollten wir endlich anfangen, faktenbasiert über Steuern und Staatsausgaben zu sprechen.
Alles andere ist nicht nur unehrlich – es ist schlicht unverschämte Polemik auf dem Rücken derjenigen, die dieses Land am Laufen halten.
Celine Nadolny ist seit 2022 Kolumnistin des Cash.-Magazins sowie von Cash.Online. 2019 gründete sie Book of Finance und wurde zu Deutschlands einflussreichster Sachbuchkritikerin. Mit mehr als 400 rezensierten Sachbüchern erhielt sie mittlerweile zwölf Branchenpreise, ist somit die mistausgezeichnete Finanzbloggerin der DACH-Region und wurde von Forbes auf die 30-Under-30 Liste aufgenommen. Celine möchte so viele Menschen wie möglich dazu inspirieren, mehr zu lesen, ihre Finanzen in die Hand zu nehmen und ein erfülltes Leben zu führen.