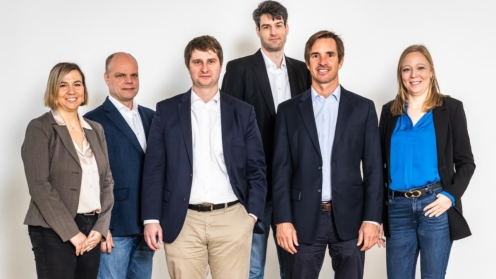Herr Steinhart, wenn Sie die bAV in einem Satz einordnen müssten: Hat sie Rückenwind oder Gegenwind?
Steinhart: Die bAV hat aktuell klar Rückenwind – auch wenn die Zahlen rückläufig sind. Das BRSG II selbst bringt keinen direkten Schub, aber der Zinsanstieg stärkt das Vertrauen. Bei einem Rechnungszins von 0,25 Prozent fragten sich viele: Wie soll da eine langfristige Rente funktionieren, über 30 Jahre Anspar- und 30 Jahre Rentenzeit? Jetzt ist wieder Substanz da. Zudem können Versicherer dem Arbeitgeber erneut die zweite Zusageform anbieten. Bis 2025 galt faktisch „Friss oder stirb“ – nur die beitragsorientierte Leistungszusage war erlaubt. Nun gibt es wieder Wahlfreiheit. Viele Berater empfinden das als komplex, tatsächlich ist es einfach und verständlich. Die bAV ist in aller Munde, Altersarmut nimmt zu, das Bewusstsein wächst. Sie bleibt die am stärksten geförderte Vorsorgeform. Über alle Schichten hinweg steht die bAV vorne: eindeutig Rückenwind.
Dickner: Das ist tatsächlich so. Wir spüren diesen Rückenwind seit Jahren. Im Neugeschäft geht es von Rekordjahr zu Rekordjahr, vor allem bei arbeitgeberfinanzierten Abschlüssen, die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Viele Arbeitgeber treffen damit den Zeitgeist und machen sich als Arbeitgeber attraktiver. Also: ganz klar Rückenwind. Die Politik könnte aber noch etwas Schub liefern – etwa durch mehr Flexibilität bei den Zusagearten. Ein Vorteil der Beitragszusage mit Mindestleistung ist, dass die Anpassungsprüfungspflicht entfällt, was höhere Renten ermöglicht. Wünschenswert wäre, dass dies auch für die BOLZ gilt. Die Aktuare wären bereit, mehr auszuschütten, dürfen es aber arbeitsrechtlich nicht. Da stellt sich die Frage: Wollen wir, dass Menschen Kapital nehmen oder Renten beziehen? Wenn Letzteres, muss die Politik hier klar nachjustieren.
Yörükoglu: Ich würde noch das Thema Opt-out hinzufügen – das wird dem Ganzen nochmal zusätzlichen Rückenwind geben. Ich beschäftige mich als Analystin viel damit. Da ich zuvor als Maklerin gearbeitet habe, habe ich aber auch gemerkt, dass die Anfragen zunehmen. Mit einem Rechnungszins von 0,25 Prozent war die bAV tatsächlich schwer zu vermitteln. Gerade ältere Arbeitnehmer haben sich gefragt, ob sich das überhaupt noch lohnt. Und viele Arbeitnehmer sind beim Thema Altersvorsorge einfach sehr träge. Aber ich glaube, die Opt-out-Regelung wird dem Thema wirklich neuen Schub geben.
Wo liegt aus Ihrer Sicht der größte Hebel, um die Verbreitung voranzubringen? Und was sind die größten Hürden?
Dickner: Die größte Hürde, aber auch die größte Chance, liegt in den Köpfen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ganz egal, was die Politik noch macht – wir müssen viel mehr Aufklärungsarbeit leisten. Wir müssen den Menschen erklären, was später passiert. Leider wollen das nicht alle hören. Ich glaube, hier liegt der größte Hebel, aber auch die größte Schwierigkeit. Ohne gut ausgebildete, beratende und transparent agierende Vermittler, die dazwischen sitzen, werden wir nicht weiterkommen. Und das wird uns keine Digitalisierung abnehmen.
Steinhart: Der wesentliche Hebel ist: Es muss deutlich einfacher werden. Ein Fachkollege hat einmal errechnet, dass es durch das BRSG I 697 Kombinationsmöglichkeiten aus Zusageformen und Durchführungswegen gibt: Das ist schlicht zu komplex. Wir wollen alle ein lebenslang verfügbares Einkommen, doch die bAV ist arbeitsrechtlich so stark belastet, dass viele Arbeitgeber beinahe Angst haben, Mitarbeiter in Rente zu schicken. Nachfinanzierungsrisiken und Rentenanpassungspflichten schrecken zusätzlich ab. Die Lösung liegt in Einfachheit: Eine bAV müsste funktionieren wie ein Sparbuch oder Girokonto – man zahlt ein, spart an und nimmt das Kapital bei Bedarf wieder mit. Diese Klarheit fehlt. Und genau das verhindert, dass es genügend „Missionare“ gibt, die Arbeitgeber wirklich begeistern. Das ist aus meiner Sicht die zentrale Hürde.

Yörükoglu: In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass die Komplexität der Versicherungsprodukte eine enorme Hürde ist. Wer nicht in der Branche tätig ist, verliert schnell den Überblick. Besonders beim Arbeitgeberwechsel oder bei Themen wie Unverfallbarkeit wird es schnell unübersichtlich. Viele Menschen haben inzwischen vier oder fünf Verträge, wissen aber kaum noch, welche Leistungen sie tatsächlich abdecken. Und viele wollen sich später gar nicht mehr damit beschäftigen, weil es einfach zu komplex geworden ist.
Dickner: In der Theorie ist alles da, was wir brauchen. Der rechtliche Rahmen ist aber zu stark reglementiert. Und er passt nicht wirklich zur Versicherungswirtschaft. Die Politik kritisiert uns an der einen Stelle, braucht uns aber an der anderen wieder als Zusatzvehikel neben der gesetzlichen Rentenversicherung. Da frage ich mich: Was denn nun? Man kann nicht das eine wollen und das andere verhindern. Die Direktversicherung bringt eigentlich alles mit, was gefordert wird – wenn der rechtliche Rahmen klarer und haftungsärmer wäre. Beim Sozialpartnermodell wird die Haftung zwar reduziert, aber mit einem völlig überladenen System aus Sicherungsbeiträgen, Pufferbildungen und anderen Vorgaben erkauft. Es überfrachtet das System und brauchen wir dies wirklich?
Gerade im KMU-Bereich ist die Durchdringung nicht gut. Was muss sich ändern, damit die bAV dort in die Breite kommt?
Steinhart: : Wir brauchen ein Pflichtmodell. Warum? Weil die Regierung der Branche mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz von 2017 fünf Jahre Schonzeit gegeben hat – und trotzdem sind die Zahlen 2025 rückläufig, weil alles zu kompliziert geworden ist. Wir treffen noch immer Arbeitgeber ohne einen einzigen Vertrag. Es gibt eine Gruppe, die bAV bewusst blockiert, und eine zweite, die bis heute keinen Pflichtzuschuss zahlt. Kaum zu glauben, dass das noch vorkommt. Hier versagt das System – Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Berater, Steuerberater und selbst DATEV, die Löhne ohne Zuschuss abrechnen. In Deutschland wird alles reguliert – aber wenn ein Arbeitgeber keine bAV anbietet, interessiert das niemanden. Das ist komplettes Systemversagen.
Ein harter Vorwurf
Steinhart: Es ist aber so. Die Branche hat die Chance vertan, durchgängig die betriebliche Altersversorgung zu etablieren. Das Einzige, was jetzt noch hilft, ist aus meiner Sicht keine Opt-out-Lösung, sondern eine echte Pflicht-bAV mit prozentualen Anteilen. Warum? Weil die gesetzliche Rentenversicherung seit Bismarck reformiert wird, ohne dass sich grundlegend etwas verbessert. Auch die Riester-Rente wird das Rentenloch nicht schließen. Deshalb bleibt nur ein konsequenter Schritt: Wir brauchen eine verpflichtende bAV, die für alle gilt. Oder wir werden das Problem nie lösen.
Dickner: Ich möchte keine bAV-Pflicht. Sie würde uns zu viel Flexibilität nehmen. Herr Steinhart hat aber recht: So wie es aktuell läuft, funktioniert es nicht. Wir brauchen zumindest eine Beratungs- und Angebotspflicht. Viele Beschäftigte wissen gar nicht, dass es in ihrem Unternehmen überhaupt eine bAV gibt – genau diese Gruppe müssen wir erreichen. Langfristig stellt sich die Frage, ob eine Pflichtlösung der richtige Weg wäre und ob man das Arbeitgebern wirklich zumuten kann. Wenn man ein verpflichtendes System einführt, dann nur mit besseren Zuschüssen. Die bisherigen 15 Prozent reichen längst nicht, das hat die Politik erkannt – sonst gäbe es beim Opt-out keine 20 Prozent. Doch auch das ist zu wenig. Wir brauchen stärkere steuerliche Anreize, damit die bAV endlich breiter genutzt wird.
Yörükoglu: Pflicht ist für mich ein sehr hartes Wort mit negativem Beigeschmack. Deshalb halte ich es für sinnvoller, über mehr Beratung und mehr Transparenz zu sprechen. Eine Beratungspflicht fände ich auf jeden Fall gut, denn viele Beschäftigte wissen gar nicht, was ihr Unternehmen überhaupt anbietet. Viele sehen ihren Arbeitgeber einfach nur als Arbeitgeber und nehmen die ganzen Zusatzleistungen gar nicht wahr – das ist ein großes Problem. Genau hier braucht es mehr Aufklärung. Außerdem finde ich, dass kleine Unternehmen oft zu kurz kommen. Sie sollten stärker staatlich gefördert werden, damit auch sie ihren Mitarbeitenden mehr bieten können.
Beim Thema bAV-Pflicht lohnt der Blick nach Schweden. Dort kam die betriebliche Altersvorsorge zunächst auch nicht richtig in Gang – bis man eine Pflicht eingeführt hat.
Dickner: Die entscheidende Frage ist, wie eine Pflicht aussehen könnte. Wenn wir wirklich über eine flächendeckende Lösung sprechen, müsste sie auch eine Arbeitgeberfinanzierung beinhalten. Nur dann hätte sie die notwendige Wirkung.
Steinhart: Wir haben bereits vier Pflichtsysteme – Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung – und keines funktioniert richtig. Statt einer weiteren Pflichtlösung plädiere ich für ein kapitalgedecktes Modell, ein echtes Sparkonto pro Arbeitnehmer mit einem Matching-System: Zahlt der Arbeitnehmer ein, legt der Arbeitgeber denselben Betrag dazu. So entsteht Eigenverantwortung und ein klarer Anreiz. Der Beschäftigte weiß: Das ist mein Konto, das nehme ich mit, egal wohin ich gehe. Der Arbeitgeber zahlt nur, wenn der Arbeitnehmer mitmacht. Das wäre deutlich einfacher und transparenter als die heutigen Regelungen mit 15 Prozent Zuschuss bei freiwilliger Entgeltumwandlung und 20 Prozent im Opt-out. Ein solches Modell könnte Beteiligungsquoten von rund 70 Prozent erreichen.
Das wäre ein anderes Pflichtsystem
Dickner: Das käme zwar nicht einer hundertprozentigen Abdeckung gleich, aber es wäre ein realistischer Schritt in Richtung des politischen Ziels. Voraussetzung wäre natürlich, dass diese Zuschüsse auch entsprechend steuerlich angerechnet werden können. Laut einer aktuellen Deloitte-Befragung würden 32 Prozent der Beschäftigten bei einem Zuschuss von 50 Prozent eine bAV abschließen. Das zeigt, wie groß der Hebel wäre. Und sie haben nicht nach 100 Prozent gefragt. Die Frage bleibt nur: Ist die Politik bereit, das den Arbeitgebern tatsächlich aufzubürden?
Yörükoglu: Mein Problem mit einer Pflichtlösung ist: Wenn sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer einzahlen müssen – können sich das überhaupt alle leisten? Große Unternehmen sicher, das ist keine Frage. Aber was ist mit kleinen Betrieben? Für viele von ihnen wäre das finanziell kaum zu stemmen. Da bräuchte es auf jeden Fall eine massive staatliche Förderung, sonst könnten gerade kleine Unternehmen schnell an ihre Grenzen kommen. Und auch für Geringverdiener wäre das schwierig – für sie müsste es besondere Entlastungen geben. Sonst droht eine Pflicht, die eher neue Probleme schafft, als sie löst.
Steinhart: Das ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte gerade einen Betrieb mit sieben Angestellten in der Beratung, die brutto zwischen 3.000 und 3.500 Euro verdienen. Netto bleiben 1.700 bis 2.300 Euro – da kann niemand 400 Euro im Monat sparen. Realistisch sind 100 Euro Entgeltumwandlung. Wenn der Arbeitgeber diese 100 Euro matcht, also ebenfalls beisteuert, entspricht das gerade einmal rund 1,7 Prozent der Jahreslohnsumme – kaum der Rede wert. Zum Vergleich: Für andere Benefits geben Arbeitgeber acht bis zehn Prozent aus. Das Risiko ist also gering. Ein Beschäftigter mit Familie kann nur das investieren, was möglich ist – meist eben diese 100 Euro. Und wenn man sieht, dass Sozialbeiträge ohnehin steigen müssten, sind 1,7 Prozent im Matching-Modell wirklich moderat.
Seite 2: „Paragaraph 100 wird der neue Riester“