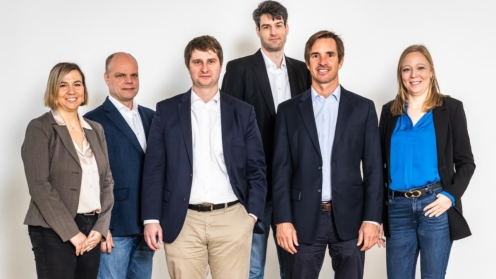Kommen wir zum Betriebsrentenstärkungsgesetz II: Welche der geplanten Neuerungen werden Ihrer Meinung nach in der Praxis etwas verändern?
Yörükoglu: Das Thema Opt-out halte ich für das spannendste, weil es den größten Effekt hätte. Die Teilnahme an der bAV würde deutlich steigen. Viele Menschen beteiligen sich heute nicht – aus Bequemlichkeit, Unwissen oder weil sie das Thema aufschieben. Mit einem automatischen Einstieg und der Möglichkeit, aktiv auszusteigen, fällt diese Hürde weg. In meiner Maklertätigkeit habe ich gesehen: Wo Unternehmen Opt-out-Modelle eingeführt haben, stieg die Beteiligung sofort. In Großbritannien etwa wuchs sie von rund 40 auf über 90 Prozent. Das zeigt, wie groß der Hebel ist. Vor allem junge Menschen befassen sich sonst kaum mit Vorsorge – das Opt-out könnte Altersarmut wirklich verringern.
Dickner: Ich befürchte, dass die rechtlichen Hürden im BRSG II erneut zu hoch sind. Wenn der Entwurf so bleibt, wird vor allem der tarifliche Verweis beim Opt-out-Modell in der Praxis zum Problem. Unter diesen Bedingungen wird das kaum funktionieren. Trotzdem sehe ich positive Ansätze, etwa bei den Sozialpartnermodellen. Sie sollten künftig breiter eingesetzt werden – besonders dort, wo es bisher keine bAV gibt. Bisher beschränken sie sich meist auf Betriebe, die ohnehin Betriebsrenten anbieten. Auch die Förderung nach §100 EStG ist stark, schade nur, dass der Zuschuss nicht auf 40 oder 50 Prozent erhöht wurde. Dennoch: Es wurden gute Weichen gestellt. Entscheidend ist, das Thema in die Köpfe der Arbeitgeber zu bringen.

Steinhart: Ich sehe das ähnlich, bin aber noch skeptischer. Das Opt-out wird in der Praxis kaum funktionieren – es ist einfach zu komplex. Selbst Fachleute können Arbeitgebern oft nicht erklären, wie sie es korrekt umsetzen sollen. Und das Sozialpartnermodell bleibt, wie ich schon 2020 sagte, ein Rohrkrepierer – es wird nicht fliegen. Den größten Hebel sehe ich klar in der Geringverdienerförderung. Dort erreichen wir endlich relevante Sparbeiträge von rund 100 Euro im Monat und erhalten bis zu 360 Euro staatliche Förderung. Die Einkommensgrenzen wurden angehoben und dynamisiert. Damit ist Paragraph100 EStG heute die stärkste geförderte Sparform in Deutschland – stärker als Riester oder Rürup. Paragraph 100 wird der neue Riester.
Dickner: Da stimme ich voll zu – Paragraph 100 ist das beste Förderinstrument der bAV seit Jahrzehnten. Der große Vorteil: Der Förderbetrag fließt immer, unabhängig davon, ob ein Unternehmen Gewinne erzielt oder nicht. Selbst Betriebe, die steuerlich entlastet sind, erhalten den Zuschuss – das wird oft übersehen und ist besonders für kleine Unternehmen ein echter Pluspunkt.
Wie stark profitieren kleine Betriebe oder Beschäftigte mit niedrigem Einkommen von den neuen Regelungen?
Dickner: Sehr stark. Paragraph 100 gibt es ja schon länger, aber die Produkte werden jetzt endlich praxisnäher und beraterfreundlicher. Aktuell nutzen laut Statistik rund eine Million Beschäftigte in 92.000 Betrieben diese Förderung – das zeigt, dass sie längst nicht nur bei Konzernen wie Bosch oder Siemens ankommt. Es sind vor allem kleine Unternehmen, die sie einsetzen. Viele Maklerbetriebe statten sogar ihre eigenen Teilzeitkräfte oder Minijobber damit aus. Für genau diese Zielgruppen ist das Modell ideal.
Es klang vorhin bereits an, dass das Opt-Out nicht überzeugt. Was müsste sich ändern, damit aus dem Papiertiger ein Gamechanger wird?
Steinhart: Ich habe da eine klare Meinung: Immer wenn die Politik ein ‚Stärkungsgesetz‘ verabschiedet, weiß man eigentlich schon, dass es zu kompliziert wird. Beim Betriebsrentenstärkungsgesetz ist das nicht anders. Statt wirklich zu stärken, hat man durch immer neue Reglementierungen alles verkompliziert. Opt-out wäre dann ein Fortschritt, wenn man diese Reglementierungen streicht – bis auf eine Widerspruchsfrist für den Arbeitnehmer. Dann könnte jeder Betrieb, ob tarifgebunden oder nicht, ein Opt-out anbieten. Der Arbeitgeber bietet es an, der Arbeitnehmer kann widersprechen – fertig. Das wäre echte Stärkung. Aber genau diese Freiheit hat man dem System genommen.
Stichwort Sozialpartnermodelle: Sie sollen durch die neuen Regeln neuen Schwung bekommen.
Steinhart: Das Sozialpartnermodell wird nie funktionieren – aus sechs klaren Gründen. Erstens: Es gibt keine garantierte Rente. Zweitens: keine garantierte Todesfallleistung – niemand weiß, was am Ende herauskommt. Drittens: Es fehlt jede Berechenbarkeit. Es gilt nicht: x Euro Einzahlung ergeben y Euro Rente, sondern nur eine Zielrente ohne feste Zusage. Viertens: Die Kapitalanlage ist fremdbestimmt, oft in sicheren, aber renditeschwachen Anlagen. Teilweise wurde Geld in Geldmarktpapiere mit zwei Prozent Zinsen investiert – bei drei Prozent Inflation, also mit negativer Realverzinsung. Fünftens: Das Modell ist das einzige Produkt am Markt mit echtem Totalverlustrisiko, weil kein Insolvenzschutz besteht. Und sechstens: Der Arbeitgeber trägt ein unkalkulierbares Kostenrisiko bis zum Tod des Mitarbeiters, auch bei ehemaligen Beschäftigten. Welcher Arbeitgeber will das? Selbst in Versicherungsunternehmen, wo das Modell entwickelt wurde, schließen Mitarbeiter lieber klassische Direktversicherungen ab, weil sie wissen, was sie erwartet. Bis heute gibt es keinen einzigen echten Abschluss, nur Tarifverträge, aber keine Konten.
Dickner: Ich sehe das ähnlich. ‚Pay and forget‘ klingt erstmal charmant, aber in der Praxis ist das System völlig überfrachtet. Die Begriffe wie Sicherungsbeiträge oder Puffermechanismen schrecken Arbeitgeber ab. Ein paar große Unternehmen wie Uniper werden vielleicht eigene Haustariflösungen aufsetzen, aber der Mittelstand? Der wird sich nicht an bestehende Systeme andocken, weder an Chemie noch an Uniper. Realistisch bleibt nur der Metzler-Pensionsfonds, und wenn der irgendwann eine Monopolstellung hat, werden die Kosten steigen. Arbeitnehmer werden von sich aus kaum einzahlen, es sei denn, die Zuschüsse sind extrem attraktiv – wie aktuell in der Chemiebranche. Aber das bleibt die Ausnahme.
Das heißt, durch die neuen Regeln wird das SPM also nicht wirklich forciert?
Dickner: Nicht in dem Maß, wie man es sich erhofft hat. Zumal das Damoklesschwert 2030 schon über uns hängt. Denn es steht ausdrücklich drin, dass die Politik die Verbreitung der Sozialpartnermodelle überprüfen will.
Warum hält man dann trotzdem daran fest?
Steinhart: Weil viele, die solche Modelle entwickeln, keine Ahnung von Versorgungssystemen haben. Politiker entwerfen etwas, ohne den Endkunden zu fragen. Wenn man einem Arbeitnehmer erklärt, dass es keine garantierte Rente, keine Todesfallleistung, keine planbare Auszahlung gibt, die Kapitalanlage fremdbestimmt ist und im schlimmsten Fall alles verloren gehen kann – warum sollte er das abschließen? Viele, die solche Gesetze schreiben, würden selbst nie so ein Produkt wählen. Ich erinnere mich noch an 2020: Da wurde mir von Branchenkollegen vorgeworfen, ich würde das Modell nur kritisieren, weil mein Versicherer es nicht anbietet. Heute, als Makler, könnte ich es frei vermitteln: Ich tue es aber nicht, weil es schlicht keinen Sinn ergibt.
Dickner: Die Grundidee ist ja nicht schlecht. ‚Pay and forget‘ klingt für Arbeitgeber attraktiv, und die Beteiligung am Kapitalmarkt ist grundsätzlich sinnvoll. Aber in der Realität funktioniert es nur, wenn Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände an einem Strang ziehen. Und das passiert kaum. Zwar wurden einige bürokratische Hürden abgebaut, etwa die Beteiligungsmodelle durch z. B. Beiräte für kleinere Andocklösungen, aber das reicht nicht. Es wird vielleicht zehn, zwanzig oder dreißig Sozialpartnermodelle geben – aber entscheidend ist, wie viele Arbeitnehmer tatsächlich erreicht werden. Und das wird überschaubar bleiben, vor allem weil viele Babyboomer in den nächsten Jahren aus der Statistik herausfallen.
Yörükoglu: Ich finde, man sollte keine Energie in so komplizierte Konstrukte stecken. Es wäre besser, etwas Einfaches aufzubauen, das wirklich funktioniert.
Was müsste sich konkret ändern?
Steinhart: Weniger Beschränkungen, mehr Freiheit. Beim Opt-out würden zwei Regeln reichen: Erstens darf jeder Arbeitgeber es anbieten, zweitens bekommt der Arbeitnehmer eine dreimonatige Widerspruchsfrist – mehr braucht es nicht. Beim Pflichtmodell braucht es klare, einheitliche Zuschüsse. Es ist absurd, dass Arbeitgeber 15 Prozent Pflichtzuschuss zahlen, obwohl sie rund 22 Prozent Sozialabgaben sparen. Wenn man das Opt-out mit 20 Prozent Zuschuss kombiniert und den Pflichtzuschuss auf 15 Prozent anhebt, wäre das fair. In der Schweiz zahlt der Arbeitgeber die Hälfte in die Pensionskasse – flexibel nutzbar, etwa für den Immobilienkauf. Ein verpflichtendes Matching-Modell mit 30 Prozent Zuschuss wäre sinnvoll. Alles darunter ist schlicht unattraktiv.
Dickner: Ich finde, die versicherungsförmigen Durchführungswege könnten ohnehin viel mehr leisten, als sie heute dürfen – arbeitsrechtlich sind sie nur zu stark eingeschränkt. Wenn man das mit einem Pflichtmodell verbindet, braucht es zwei Dinge: höhere Zuschüsse und weniger Haftung. Warum sollen Arbeitgeber in Systemen haften, in denen ohnehin schon Garantien oder Haltelinien eingebaut sind? Selbst die Zielrente ist ja nichts anderes – nur ohne untere Grenze. Wenn man diese unnötigen Haftungsthemen streicht, wären Arbeitgeber sicher bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Mit höheren Zuschüssen und klaren Regeln könnte daraus ein tragfähiges Modell entstehen.
Seite 3: