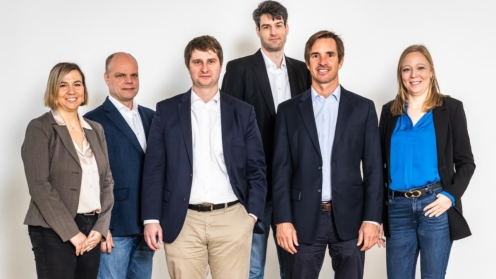Lassen Sie uns einmal auf die Garantien schauen. Bis zu 80 Prozent sollen künftig möglich sein. Ist das, was der Gesetzgeber vorsieht, aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
Steinhart: Durch den höheren Rechnungszins können Anbieter wie der Volkswohl Bund wieder die Beitragszusage mit Mindestleistung anbieten – historisch gesehen die einfachste Form nach der reinen Beitragszusage. Der Arbeitgeber zahlt ein, erhält später eine Leistung zurück und trägt nur ein begrenztes Risiko. Es gibt keine Rentenanpassungspflicht, keine Verzugsrisiken und keine Fallstricke wie bei Leistungszusagen. Viele glauben, Garantie und Fonds passen nicht zusammen – das stimmt nicht. Moderne Zwei-Topf-Systeme funktionieren seit über zehn Jahren erfolgreich. Nun entstehen auch für Paragraph 100 echte fondsgebundene Policen. Früher waren 90 Prozent klassische Rentenpapiere, jetzt werden Produkte flexibler, nachhaltiger und kostengünstiger. Wir arbeiten ausschließlich mit Gruppenkonditionen zugunsten der Arbeitnehmer – auch beim Arbeitgeberwechsel bleiben diese erhalten. So entstehen faire, zukunftsfähige bAV-Lösungen.
Dickner: Die neue Zinswelt eröffnet neue Möglichkeiten. Ich bin überzeugt, dass man auch wieder solide Vollgarantieprodukte auf den Markt bringen kann – wir haben selbst eines. Gleichzeitig ist es gut, dass man bei Fondspolicen jetzt auch mit abgesenkten Garantien arbeiten darf. Viele sagen ja: Die 80 ist die neue 100. In gewisser Weise stimmt das, aber eine hundertprozentige Entlastung – also völlige Haftungsfreiheit – gibt es für den Arbeitgeber trotzdem nicht. Ein Restrisiko bleibt. Ich halte 80-Prozent-Modelle mit Aufbaumechanismen, also Garantien, die im Zeitverlauf steigen und am Ende sogar über 100 Prozent liegen können, für sehr sinnvoll. In Kombination mit einer hohen Fondsquote ist das ein stimmiger Ansatz. Weiter runterzugehen halte ich dagegen für wenig sinnvoll, weil der Zusatznutzen zu gering wird.
Steinhart: Genau. Solche Produkte mit minimaler Garantie will auch niemand abschließen. Wenn jemand 30 Jahre lang jeden Monat 100 Euro einzahlt und ihm am Ende eine garantierte Rente von 30 Euro in Aussicht gestellt wird, dann schreckt das ab – selbst wenn die Investmentquote hoch ist. Wenn ich ihm aber mit einer anderen Zusageform bei gleichem Versicherer und gleichem Grundzins eine garantierte Rente von 120 Euro bieten kann, fühlt sich das ganz anders an. Das ist für den Kunden greifbar, und der Arbeitgeber ist trotzdem weitgehend aus der Haftung raus. Das ist die Kombination, die funktioniert: Sicherheit mit gesundem Maß an Renditechance.
Entscheiden sich die Arbeitgeber eher für 80 oder für 100 Prozent Garantie?
Dickner: Viele Arbeitgeber wählen heute die 80-Prozent-Variante. Dabei spricht wenig dagegen, weiterhin eine Beitragszusage mit Mindestleistung und Vollgarantie zu nutzen. Ich bezweifle, dass diese Entwicklung vom Arbeitgeber selbst ausgeht – oft beeinflussen Vermittler die Entscheidung. Ein Makler soll den „Best Advice“ geben. Wenn er überzeugend erklärt, dass 80 Prozent Garantie durch höhere Renditechancen ausgeglichen werden, folgt der Arbeitgeber meist. Am Ende bleibt es eine Vertrauensfrage: Wie sehr vertraut der Arbeitgeber seinem Makler – und der Arbeitnehmer wiederum dieser Empfehlung? Genau das ist letztlich der entscheidende Punkt.
Yörükoglu: Die Mehrheit hat sich tatsächlich für die 80-Prozent-Lösung entschieden – einfach, weil sie attraktiver verkauft wurde und viele gar nicht so genau wissen wollten, was dahintersteckt.
Dickner: Und das hält bis heute an. Anfangs dachten wir, das sei nur eine Phase – bedingt durch die hohe Inflation und die Angst vor realen Verlusten. Aber auch jetzt, wo die Inflation wieder moderater ist, bleibt die Nachfrage nach fondsbasierten Modellen mit geringeren Garantien konstant hoch. Das scheint sich dauerhaft etabliert zu haben.
Stichwort ESG. Nachhaltigkeit ist Pflicht, Rendite bleibt Kür – lässt sich beides in der bAV überhaupt miteinander vereinbaren? Was sagen Kunden, was sagt der Vertrieb?
Steinhart: Vor drei Jahren gab es einen regelrechten ESG-Hype – damals floss etwa jeder dritte Euro in nachhaltige Fonds. Heute ist das Thema deutlich abgeflaut. Den meisten Kunden ist es inzwischen egal, wo ihr Geld liegt. Warum? Weil die Fondsbranche ihre Produkte so angepasst hat, dass fast jeder Fonds als ESG-konform gilt – unabhängig von echter Nachhaltigkeit. Rund 90 Prozent aller Fonds tragen heute ein ESG-Label, oft ohne Substanz. Ein „nachhaltiges Zielportfolio“ bedeutet nicht, dass das Produkt selbst nachhaltig ist. Das ist häufig reines Marketing. Wenn etwa eine traditionsreiche deutsche Großbank einen ESG-Fonds anbietet, wirkt das wenig glaubwürdig – auch wenn das Portfolio auf dem Papier grün aussieht.
Yörükoglu: Das mit der Marketingstrategie stimmt absolut. Nachhaltigkeit ist heute für viele einfach ein Verkaufsargument. Jeder will, dass alles ‚grün‘ wirkt. Der Hype ist meiner Meinung nach immer noch da – aber nicht, weil alle so nachhaltig denken, sondern weil ESG ein starkes Marketinginstrument geworden ist. Das zieht einfach gut, auch wenn es oft nur oberflächlich ist.
Dickner: Für viele Arbeitgeber ist es tatsächlich eine Art Pflicht geworden. Viele müssen selbst zu ESG-Themen berichten, intern wie extern. Da hilft es, wenn man sagen kann: ‚Unsere bAV ist ESG-konform‘ – am besten mit Fonds nach Artikel 8 oder 9. Das macht sich in der Außendarstellung gut. Manche hängen sich sogar Zertifikate ins Büro, auf denen steht, dass ihre bAV nachhaltig ist – was das konkret bedeutet, bleibt oft offen. Ich stimme aber zu: Der große Hype ist vorbei. Vielleicht kommt er zurück, wenn die Reportingpflichten noch strenger werden. Versicherer müssen ESG-Produkte natürlich anbieten, und das tun wir auch. Aber unsere nachhaltige Produktlinie wurde vor zwei, drei Jahren deutlich stärker nachgefragt als heute.
Kommen wir zur bAV-Umsetzung in den Betrieben: Wo liegen in der täglichen Verwaltung die größten Stolperfallen?
Dickner: Aber mit den heutigen Lohnabrechnungsprogrammen, die praktisch alles abbilden können, ist Verwaltung an sich kein Problem mehr. Wichtig ist, dass man einen verlässlichen Vermittler hat – also jemanden, der regelmäßig da ist, sich kümmert und bei Fragen unterstützt. Wenn der Makler aktiv bleibt und die Schnittstelle zum Versicherer hält, dann gibt es kaum Stolperfallen.
Yörükoglu: Ich sehe das ein bisschen anders. In der Praxis funktionieren viele Systeme einfach nicht so, wie sie sollen. Vieles muss immer noch manuell eingetragen werden, da gehen Daten verloren, es schleichen sich Fehler ein – das sorgt intern für Stress und fehlerhafte Angaben. Verwaltung muss dringend moderner und einheitlicher werden. Das ist wirklich ein großes Problem.
Steinhart: Ich sehe das ganz anders. Früher hieß es: „Niemand läuft 100 Meter unter zehn Sekunden“ – und genau so denken viele Arbeitgeber über die bAV. Sie glauben, Verwaltung sei kompliziert, obwohl sie nie erlebt haben, wie einfach es heute ist. Alles läuft digital: Beratung, Anmeldung, Abmeldung, Lohnfortzahlung, Beitragsfreistellung – komplett automatisiert. Wenn ein Mittelständler wüsste, dass er dafür nur etwa ein Stunde pro Woche braucht, würde er sofort mitmachen. Liegt die Fondsgestaltung beim Arbeitnehmer und die Verwaltung beim Makler, bleibt für den Arbeitgeber kaum Aufwand übrig.
Yörükoglu: Theoretisch stimmt das, aber praktisch ist es immer noch schwierig. Jeder Betrieb hat andere Systeme, manche funktionieren besser, manche schlechter. Wenn die Prozesse einheitlich wären und alle mit denselben Tools arbeiten würden, wäre es deutlich einfacher. So entsteht viel Reibung.
Steinhart: Das größte Problem ist, dass viele Mittelständler §1 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes gar nicht nutzen. Dabei erlaubt dieser Paragraf dem Arbeitgeber, selbst zu bestimmen, welchen Durchführungsweg und welchen Versicherer er wählt. Das heißt: Er kann sich einen Versicherer aussuchen, einen Gruppenvertrag abschließen und alles über ein Portal laufen lassen – wie die großen Unternehmen auch. Bei Bosch bringt auch niemand seinen eigenen Vertrag mit, dort gibt es ein zentrales Versorgungswerk. Genau das kann auch der Mittelstand machen. Dann läuft alles digital, sauber und effizient.
Dickner: Und wenn der Arbeitgeber dann noch einen Makler hat, der sich aktiv kümmert und das Mandat exklusiv betreut, dann funktioniert auch die Portierung alter Verträge. Zentralisierung ist da das Stichwort.
Wie läuft es beim kleinen Unternehmen mit sieben Mitarbeitenden konkret?
Steinhart: Ganz einfach: Wir setzen ein digitales Mitarbeiterportal auf, zum Beispiel über Xempus. Dort können die Beschäftigten selbst ihre Vorsorge einsehen, simulieren und verwalten – ganz ohne komplizierte Dateneingaben. Wir richten einen Gruppenvertrag ein, mit fairen Konditionen, und die An- und Abmeldungen laufen voll digital. Die gesamte Verwaltung übernehmen wir. Der Arbeitgeber spricht einmal mit uns über die Versorgungsordnung und den Zuschuss – das war’s. Dank Entbürokratisierungsgesetz geht alles in Textform, also digital per Mausklick.
Dickner: In so kleinen Betrieben macht das in der Regel der Steuerberater mit, und da fällt vielleicht alle paar Monate mal ein Vorgang an. Dafür lohnt sich kein separates Programm. Der Makler ist da einfach viel versierter und näher dran an der Praxis. Der übernimmt das schneller, einfacher und vor allem mit dem nötigen Know-how.
Steinhart: Das Gegenbeispiel dazu: Ich betreue einen Arbeitgeber mit 4.000 Beschäftigten und zwölf Personalabteilungen – aufgeteilt nach Buchstabenbereichen. Es wird klar kommuniziert: ‚Wenn du mir keine digitale Schnittstelle bringst, bist du raus.‘ Der Kunde will, dass alles vollautomatisch läuft. Keine manuellen Eingaben, keine doppelten Wege, kein Portal, in dem Mitarbeitende noch selbst etwas eintragen müssen. Für solche Unternehmen bauen wir Schnittstellenlösungen und arbeiten ausschließlich mit Versicherern, die diese digitale Integration auch tatsächlich liefern können.
Stichwort Schnittstellen – wohin geht dort die Reise?
Steinhart: Wir nutzen inzwischen KI, um Schnittstellen schneller zu entwickeln. Die Zukunft liegt aber in Multi-Portalen: Arbeitgeber wollen Plattformen, auf denen alle Benefits gebündelt sind – bAV, betriebliche Krankenversicherung, Sachbezugskarten, Diensträder. Neue Mitarbeiter werden einmal angelegt, alle Leistungen automatisch aktiviert, beim Austritt wieder abgemeldet. Die bAV ist dabei nur ein Baustein – ein Benefit unter vielen.
Dickner: Wir als Versicherer sind ja nur der Mantel für die bAV – andere Benefits liegen außerhalb unseres Portfolios. Aber wir arbeiten eng mit Maklern und Vertrieben zusammen, um Schnittstellen sauber anzubinden. Inzwischen sind wir an drei große Portale angeschlossen. Und man muss sagen: Xempus ist im Maklermarkt führend. Ich würde es nicht das „SAP der bAV“ nennen, aber in Sachen Marktdurchdringung und technischer Vernetzung ist es für viele Arbeitgeber derzeit die beste Lösung.
Apropos Arbeitgeber – welche Unterstützung erwarten sie vom Vertrieb und von den Versicherern?
Steinhart: Das Wichtigste ist: Versicherer müssen endlich zuhören. Ich berate einen Arbeitgeber mit 4.000 Beschäftigten, für den ich zwölf Versicherer anfragte – nur wegen einer funktionierenden Schnittstelle. Manche fragten ernsthaft: „Wofür brauchen Sie das?“ Damit war das Gespräch eigentlich beendet. Versicherer müssen verstehen, dass es heute um Prozesse geht, nicht nur um Produkte. Produkte ähneln sich, entscheidend ist die Effizienz. Manche Anbieter arbeiten noch nach dem Prinzip: Vorne digital melden, dass ein Mitarbeiter ausgeschieden ist und dann läuft eine Papierakte durch drei Abteilungen und nach acht Wochen stoppt endlich der Einzug für einen ausgeschiedenen Mitarbeiter. Das sieht digital aus, ist es aber nicht.
Yörükoglu: Ich habe das in meiner Zeit in der Verwaltung auch erlebt. Viele Prozesse waren komplett manuell – man musste jeden Mitarbeitenden einzeln abmelden. Das hat ewig gedauert und natürlich Fehler produziert. Inzwischen wird zwar immer mehr digitalisiert, aber es ist noch nicht da, wo es sein sollte. Das Ganze muss viel schneller werden. Solche Verzögerungen sorgen nämlich für Frust – und genau dadurch entsteht dieses Image, dass die bAV zu kompliziert und aufwendig sei. Das schreckt viele Arbeitgeber ab.
Dickner: Arbeitgeber erwarten neben digitaler Abwicklung heute vor allem zwei Dinge von Versicherern und Vermittlern. Erstens: ehrliche, transparente Beratung statt Schnellverkauf. Sie wollen verstehen, was sie abschließen, und auf dieser Basis fundiert entscheiden. Leider gibt es noch schwarze Schafe, die Vertrauen zerstören. Zweitens: Flexibilität. Das Arbeitsleben ist heute viel dynamischer. Produkte müssen anpassbar sein – bei Rentenbeginn, Beiträgen, Unterbrechungen oder Störfällen. Früher war es oft so: beitragsfrei gestellt, wieder in Kraft gesetzt, neue Rechnungsgrundlagen, neue Sterbetafeln: so funktioniert das heute nicht mehr.

Wo liegen aktuell die größten vertrieblichen Herausforderungen in der bAV?
Steinhart: Die größte Herausforderung ist, das Wissen weniger Experten auf viele Vermittler zu übertragen. Jeder muss in der Lage sein, transparent und fachlich sauber zu beraten. Der zweite Punkt ist Vertrauen: Arbeitgeber und Arbeitnehmer dürfen keine versteckten Fallen hinter einem bAV-Angebot vermuten. Leider wird die bAV oft schlechtgeredet – vor allem von Banken oder Fondsvertrieben, die eigene Produkte pushen. Das verunsichert Kunden. Dabei geht es nicht um ein Entweder-oder: Gute Vorsorgeberatung verbindet betriebliche Altersvorsorge und privaten Fondssparplan.
Kürzlich veröffentlichte eine Verbraucherzentrale eine Meldung, dass Lebensversicherungen für die Altersvorsorge eigentlich nicht geeignet sein. Wie stehen Sie dazu?
Dickner: Ehrlich gesagt gibt’s nichts anderes, was besser geeignet wäre – solange wir von Altersversorgung reden und nicht über andere Sparprozesse.
Steinhart: Das ist reine politische Stimmungsmache. So wie die SPD sagt, die Schwarzen sind schlecht, und die CDU sagt, die Roten sind schlecht. Wenn alle Parteien wirklich dasselbe Ziel hätten – nämlich ein auskömmliches Renteneinkommen für die Menschen in Deutschland – dann hätten wir das Thema längst gelöst. Aber so redet jeder aneinander vorbei.
Yörükoglu: Für mich ist das Thema Transparenz entscheidend. Viele Menschen glauben, Versicherer oder Makler wollen nur verkaufen und an ihnen verdienen. Das ist das Hauptproblem. Wenn man aber alles offenlegt – Kosten, Ablauf, Nutzen – dann entsteht Vertrauen. Eine ehrliche und transparente Beratung ist das A und O. So fühlen sich am Ende alle gut: der Makler, der Versicherer und vor allem der Kunde.
Brauchen wir in dem Zusammenhang nicht mehr finanzielle Bildung?
Dickner: Das würde sicher helfen, keine Frage. Aber am Ende sitzen sich immer noch zwei Menschen gegenüber – ob digital oder persönlich – und es geht um Vertrauen. Das muss man aufbauen, immer wieder. Auch bei Arbeitgebern und Mitarbeitenden. Verbraucherschützer haben ihre Berechtigung, aber sie sollten faktenbasiert argumentieren. Eine bAV ist mit einer Trading-App wie Trade Republic zu vergleichen, ist Unsinn. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Natürlich kann man es betriebswirtschaftlich mit einem Fondssparplan vergleichen, aber worüber reden wir hier eigentlich? Über Altersvorsorge, also eine Ergänzung zur gesetzlichen Rente. Und da müssen Versicherer ehrlich bleiben, keine versteckten Klauseln, keine faulen Tricks. Und auch die Vermittler sollten fair bleiben: Nur weil ein Vertrag nicht von ihnen stammt, ist er nicht automatisch schlecht.
Wie überzeugt man Beschäftigte, die über Social Media oder TikTok ganz andere Botschaften hören?
Steinhart: Der entscheidende Faktor ist Zeit: sie ist heute die höchste Form von Wertschätzung. Viele Arbeitgeber investieren viel Geld in Benefits, nehmen sich aber keine Zeit für echte Aufklärung. Das ist ein Fehler. Eine bAV ist keine Kurzentscheidung, sie läuft über Jahrzehnte – etwa 30 Jahre Anspar- und 30 Jahre Rentenzeit. Dafür braucht es Zeit in der Beratung, keine 20 Minuten, sondern mindestens eine Stunde, um Riester, Rente, Fonds, Steuern und Sozialversicherung verständlich zu erklären. Das ist Finanzplanung, kein Verkauf. Und was viele vergessen: Unsere Branche ist extrem transparent. Auf Seite 1 jedes Produktinformationsblatts steht, was das Produkt kostet und was der Berater verdient – das gibt es sonst nirgends.
Dickner: Am Ende bleibt Kommunikation das A und O. Der Zeitfaktor ist ganz entscheidend – kombiniert mit dem finanziellen Engagement. Wir dürfen uns nichts vormachen: Es geht am Ende um Geld, um Altersvorsorge, um Absicherung. Deshalb muss das Verhältnis zwischen Zeit, die der Arbeitgeber bereitstellt, und dem Zuschuss, den er leistet, einfach stimmen. Ein hoher Zuschuss ohne vernünftige Beratung oder eine gute Beratung ohne nennenswerten Zuschuss – beides verpufft. Es braucht die richtige Balance.
Yörükoglu: Zu viel Zeit macht es nicht immer besser. Viele Beschäftigte haben es einfach eilig – das habe ich in der Praxis oft erlebt. Wenn man sagt, die Beratung dauert 45 Minuten, winken viele gleich ab. Sie wollen es schnell, aber trotzdem umfassend. Das ist schwierig, da muss man die goldene Mitte finden. Manche wollen keine Stunde investieren, wollen aber trotzdem alles verstehen. Und das Thema Kosten spielt auch immer eine Rolle – viele fragen nach, warum etwas so viel kostet. Aber gleichzeitig wollen sie sich nicht die Zeit nehmen, es genau zu verstehen. Das ist schade, weil es ja um die eigene Zukunft geht – um 60 Jahre Absicherung. Aber so ist die Realität.
Letzte Frage: Wenn Sie der Politik oder der Branche eine Empfehlung mitgeben könnten – welche wäre das?
Dickner: Wir brauchen endlich Klarheit: Klarheit in den Systemen, im Arbeitsrecht, in der Auslegung zentraler Begriffe. Nicht dieses ‚Das müssen dann irgendwann die Gerichte entscheiden‘. Das lähmt alles. Paragraph 16, das Thema Wertgleichheit – seit 20 Jahren ist das unklar, ein undefinierter Begriff im Gesetz. Da dürfen wir uns nicht wundern, wenn Arbeitgeber unsicher sind. Und wir brauchen Mut. Mut, auch mal kreative Pflichtmodelle zu denken, selbst wenn ich kein Fan von Zwang bin. Aber mit weniger Haftungsrisiko und vernünftigen betriebswirtschaftlichen Anreizen – für Arbeitgeber und Arbeitnehmer – könnten wir richtig etwas bewegen.
Steinhart: Meine Empfehlung an Politik und Branche ist einfach: Bitte verliert den Kunden nicht aus dem Blick. Ich habe es vorhin schon gesagt – zu viele Menschen bauen Versorgungssysteme, ohne je mit einem echten Kunden gesprochen zu haben. Das funktioniert nicht. Man muss verstehen, wie Menschen ticken, wie sie Entscheidungen treffen und wo ihre Ängste liegen. Nur dann kann man ein System bauen, das wirklich funktioniert.
Yörükoglu: Ich würde mir wünschen, dass man auf beiden Seiten vieles einfacher macht. Weniger Bürokratie, weniger komplizierte Regeln. Klar, Regeln braucht es – aber bitte nicht so viele, dass man sich darin verliert. Es sollte mehr Freiheit geben, Dinge flexibel umzusetzen. Nur so kann man die Menschen wirklich erreichen.
Dieser Artikel ist Teil des EXTRA bAV. Alle Artikel des EXTRA finden Sie hier.