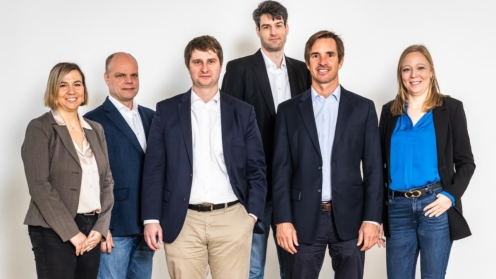Was ist eine Versorgungsordnung – und warum braucht man sie? Die Versorgungsordnung ist wie ein detaillierter Fahrplan für die betriebliche Altersversorgung in dem jeweiligen Unternehmen. Dieses interne Regelwerk hält alle relevanten Aspekte fest: Für wen soll die Versorgungsordnung gelten? Wer hat Anspruch? Welche Leistungsarten werden zugesagt? Wer leistet welche Versorgungsbeiträge? Wie erfolgt die Abwicklung, also beispielsweise über welchen Durchführungsweg soll die Versorgung erfolgen?
Oder aber auch für den späteren Versorgungsfall wird beschrieben, an wen sich der Versorgungsberechtigte dann wenden kann, welche Unterlagen vorzulegen sind, etc.? Es werden also auch Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern festgelegt. Das Ziel ist klar: Die bAV soll transparent, rechtlich korrekt und effizient strukturiert werden.
Die Versorgungsordnung ist also kein bloßes Formular, sondern ein strategisches Werkzeug mit vielfältigem Nutzen. Sie bietet nicht nur die rechtliche Absicherung, sie steigert auch die betriebliche Effizienz und stärkt ebenfalls das Arbeitgeberimage. Die Versorgungsordnung eignet sich für alle Durchführungswege. Durch die schriftliche Fixierung aller Regelungen wird sichergestellt, dass die bAV stets im Einklang mit dem Betriebsrentengesetz (BetrAVG) steht.
Das minimiert nicht nur Haftungsrisiken, sondern beugt auch potenziellen arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen vor. Gleichzeitig schafft die Versorgungsordnung Transparenz für die Belegschaft. Mitarbeiter erhalten einen klaren Überblick über ihre Ansprüche, vertragliche Rahmenbedingungen und mögliche Zusatzleistungen. Das schafft Vertrauen und erhöht die Akzeptanz der bAV im Unternehmen.
So hat der Arbeitgeber individuelle Spielräume, die Versorgungsordnung zu gestalten:
Der Teilnehmerkreis umfasst in der Regel die gesamte Belegschaft. Allerdings gibt es auch Ausnahmen: Beispielsweise kann für Auszubildende bei einer arbeitgeberfinanzierten Versorgung vereinbart werden, dass sie erst nach Abschluss ihrer Ausbildung und Übernahme in den Betrieb teilnehmen, während sie an der Entgeltumwandlung sofort teilnehmen können. Ebenso kann bei der arbeitgeberfinanzierten Versorgung eine sogenannte Wartezeit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen werden. Das ist insbesondere dann interessant, wenn auch Berufsunfähigkeitsleistungen angeboten werden, die nicht über Versicherungen finanziert werden oder wenn Arbeitgeber für die Beiträge, die sie aufwenden, abwarten wollen, ob die eingestellten Mitarbeiter auch bleiben. So lässt sich auch der Verwaltungsaufwand begrenzen.
Wichtig zu regeln ist auch, wie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgegangen wird, die bereits eine Versorgung im Unternehmen haben. Ziel ist es natürlich, eine Doppelversorgung zu vermeiden. Hier ergeben sich diverse Gestaltungsmöglichkeiten: Entweder können diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre bisherige Versorgung fortführen oder sie können die alte Versorgung beitragsfrei stellen und an der neu angebotenen Versorgung teilnehmen oder es wird ein Anrechnungsmodell vereinbart.
Der Arbeitgeber kann den Durchführungsweg festlegen. Gegebenenfalls bestehen auch mehrere Durchführungswege, die dann im Einzelnen in der Versorgungsordnung erklärt werden bzw. die Bedingungen für die einzelnen Durchführungswege erläutert werden und auf diese Weise auch für Transparenz sorgen.
Oftmals werden in der Versorgungsordnung mischfinanzierte Formen gewählt, also beispielsweise eine Entgeltumwandlung zuzüglich des obligatorischen Arbeitgeberzuschusses und darüber hinaus ein weiterer Arbeitgeberbeitrag. Soweit ein Arbeitgeberbeitrag aufgewendet werden soll, kann der Arbeitgeber hier die Einzelheiten festlegen. So sollte auch geregelt werden, wie lange Beiträge geleistet werden sollen und welche Regelungen gelten sollen, wenn das Arbeitsverhältnis ruht oder anderweitig unterbrochen wird. Hier stellen sich Fragen nach dem Aussetzen oder Weiterlaufen der Beiträge. Bei versicherungsförmigen Durchführungswegen oder rückgedeckten Versorgungszusagen sollte dies in Abstimmung mit dem Versicherer vorgenommen werden, damit die Versicherungsverträge und die Versorgungsordnung im Einklang stehen und keine unterschiedlichen Regelungen aufweisen.
Spielräume für den Arbeitgeber ergeben sich auch bei der Hinterbliebenenversorgung. So kann er hier festlegen, an wen im Todesfall des Versorgungsberechtigen Hinterbliebenenleistungen fließen sollen. Unter anderem ist es auch möglich, unter bestimmten Voraussetzungen, Lebensgefährten mit aufzunehmen. Bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen sind die Tarife in der Regel so gestaltet, dass der arbeits- und steuerrechtlich zulässige Personenkreis komplett abgebildet werden kann, aber nicht zwingend muss. Wenn der Arbeitgeber die Zusage dagegen ohne entsprechende Rückdeckung finanziert, wird er sich gegebenenfalls eher überlegen, hier zulässige Begrenzungen vorzunehmen, beispielsweise bei der Ehezeitdauer, die erfüllt sein muss, um Leistungen zu beziehen, bei Heiraten nach Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis oder zu zulässigen sogenannten Altersabstandsklauseln.
Unabhängig von der Gestaltung im Einzelfall: Eine standardisierte Versorgungsordnung ist auch ein wichtiges Instrument in der Verwaltung. Sie vereinfacht interne Prozesse, von Neueinstellungen über Vertragsänderungen bis zum Austausch mit Versicherungsträgern, und reduziert so den administrativen Aufwand spürbar. Ihre Stärke liegt auch in der Flexibilität: Die Versorgungsordnung kann individuell auf die Unternehmensstruktur und die Bedürfnisse der Mitarbeiter zugeschnitten werden. Sie lässt sich bei Bedarf schnell an geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen oder betriebliche Entwicklungen anpassen.
Nicht zuletzt hat eine gut strukturierte bAV einen positiven Effekt auf die Außenwirkung des Unternehmens. Sie stärkt das Arbeitgeberimage und wird zu einem wichtigen Argument bei der Gewinnung und langfristigen Bindung qualifizierter Fachkräfte.
Warum die Versorgungsordnung geradeim Mittelstand besonders glänzt
Gerade für mittelständische Unternehmen kommt der Versorgungsordnung eine besondere Bedeutung zu. Sie stehen häufig vor der Herausforderung, mit begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen wettbewerbsfähig zu bleiben und qualifizierte Fachkräfte langfristig zu binden. Durch eine transparent formulierte und rechtlich geprüfte Regelung der bAV positioniert sich das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber und stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit im hart umkämpften Arbeitsmarkt. Da viele Mittelständler nicht über eigene Rechtsabteilungen verfügen, bietet eine Versorgungsordnung zusätzlich Schutz vor arbeitsrechtlichen Risiken.
Fazit: Eine Investition, die sich auszahlt
Jedes Unternehmen, das eine bAV einführt oder bereits anbietet, profitiert von einer Versorgungsordnung. Auch bei den einzelnen Leistungsarten wie Altersleistungen, Hinterbliebenenabsicherung und/oder Berufsunfähigkeitsschutz ist sie sehr hilfreich, weil dort detailliert beschrieben wird, welche Voraussetzungen für die einzelnen Leistungsarten zu erfüllen sind und der Arbeitgeber hierbei auch gewisse Spielräume besitzt. Bei unterschiedlichen Regelungen für verschiedene Mitarbeitergruppen sichert sie zudem den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz ab. Versorgungsordnungen sind weit mehr als nur eine formale Ergänzung zur betrieblichen Altersversorgung. Die Investition zahlt sich langfristig in Form von Mitarbeiterzufriedenheit und einer rechtlich korrekten und planungssicheren Umsetzung aus.
Autorin Anja Sprick ist Justiziarin bei Longial