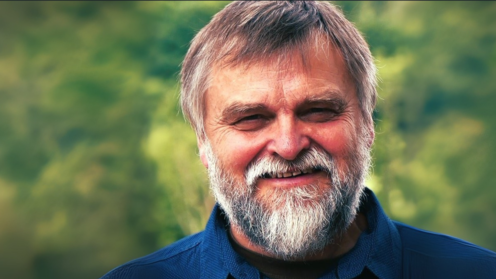Herr Jaffke, die BaFin forciert die Umsetzung von Wohlverhaltenspflichten und Value for Money. Was ist aus Ihrer Sicht der zentrale Wendepunkt gegenüber der bisherigen Aufsichtspraxis in Deutschland?
Jaffke: Einen Wendepunkt würde ich vielleicht noch nicht ausrufen – das ist ein sehr starkes Wort. Bisher lag der Fokus der BaFin eher auf der Finanzstabilität der Versicherungsunternehmen, Stichwort Solvency II. Jetzt sehen wir, dass eine neue Perspektive hinzukommt. Das zeigt sich in den jüngsten Mitteilungen der BaFin und auch in den Auftritten von Führungspersonen auf Veranstaltungen: Die Themen Verbraucherschutz und Kundennutzen rücken stärker in den Mittelpunkt. Wenn diese Entwicklung konsequent weitergeht, könnte man in Zukunft durchaus von einem Wendepunkt sprechen. Im Moment würde ich es eher als Perspektivenwechsel beschreiben.
Viele europäische Länder wie England, Irland oder die Niederlande setzen seit Jahren konsequent auf Nutzenprüfungen. Warum hat sich die deutsche Branche dort bislang so schwergetan?
Jaffke: Man muss sehen, dass Länder wie UK, Irland oder die Niederlande insgesamt eine andere Haltung zu Finanzprodukten haben. Dort gibt es schon lange ein Provisionsverbot. Aus meiner Sicht ist das der falsche Weg, wie sich mittlerweile zeigt. Denn dadurch wird vielen Menschen der Zugang zu qualifizierter Finanzberatung erschwert.
Gleichzeitig hat man in diesen Märkten stärker die Kundensicht eingenommen und war bei Themen wie Value for Money schlicht früher unterwegs. Für Deutschland ist entscheidend, diesen Fokus ebenfalls zu verstärken, ohne die Diskussion automatisch mit einem Provisionsverbot zu verknüpfen. Denn die Vergütungsform hat aus meiner Sicht nichts mit der Beratungsqualität zu tun.
Warum ist das Provisionsverbot in Deutschland nach wie vor ein so großes Thema? Die Diskussionen scheinen ja nicht abzureißen.
Jaffke: Ganz vom Tisch ist das Thema nicht, es kommt immer wieder hoch. Die Diskussion ist in Deutschland oft zu einseitig: Provisionsberatung gilt pauschal als schlechter, was ich so nicht sehe. Entscheidend ist die Qualität des Beraters, nicht die Vergütungsform. Ob Honorar oder Provision – ausschlaggebend ist die Qualifikation. Zudem gibt es schon heute viele Vermittler, die je nach Situation beide Modelle anbieten. Das ist rechtlich zulässig und gängige Praxis. Am Ende sollten Kunde und Berater gemeinsam entscheiden, welche Vergütungsform im konkreten Fall die passende ist.
Lassen Sie uns zur Rolle der privaten Altersvorsorge in diesem veränderten Umfeld kommen. Wir sehen wachsende Versorgungslücken. Damit bekommt private Altersvorsorge mehr Relevanz. Kann der Value-for-Money-Ansatz helfen, das Vertrauen der Verbraucher in Lebensversicherungen und ihre Anbieter zu stärken?
Jaffke: Das sehe ich ganz klar so. Bei einem komplexen Finanzprodukt wie der Lebensversicherung handelt es sich im Idealfall um eine Entscheidung fürs Leben. Der Kunde muss sicher sein, dass das Produkt zu seinen persönlichen Zielen passt – und diese Ziele müssen zuvor von einem qualifizierten Berater herausgearbeitet werden. Vertrauen in das Produkt ist daher zentral. Wenn durch den Value-for-Money-Ansatz mehr Transparenz entsteht und der Kundennutzen klarer wird, dann stärkt das automatisch auch das Vertrauen.
Welche Rolle spielt dabei die Fondspolice oder die klassische Lebensversicherung? Bekommt Letztere unter den Value-for-Money-Bedingungen Probleme oder erleben wir eher eine Renaissance?
Jaffke: Von einer Renaissance würde ich nicht sprechen, weil die Fondspolice in ihren verschiedenen Ausprägungen das führende Altersvorsorgeprodukt ist. Reine Garantieprodukte spielen dagegen heute eine immer geringere Rolle. Spannend wird es bei komplexeren Lösungen wie den Hybridprodukten, die Renditechancen mit einem gewünschten Garantie- oder Absicherungsniveau kombinieren. Diese Mechanismen sind für Kunden oft schwer zu verstehen. Genau hier bietet Value for Money einen Mehrwert: Über Chance-Risikoprofile und transparente Darstellungen lassen sich Rendite-Garantie-Verhältnisse und Funktionsweisen besser nachvollziehen. Das schafft Orientierung – und am Ende auch Vertrauen.
Warum legen die Deutschen eigentlich so viel Wert auf Garantien? In angelsächsischen Ländern ist das ja nahezu verpönt.
Jaffke: Das hängt stark mit der Mentalität des deutschen Sparers zusammen. Milliarden liegen auf niedrig verzinsten Tages- und Festgeldkonten – Ausdruck eines ausgeprägten Sicherheitsbedürfnisses. Im angelsächsischen Raum wird Risiko dagegen viel eher akzeptiert. Hierzulande führen schon Einmalbeitragspolicen mit minimaler Garantieverzinsung zu regelrechten Booms. Rendite ist zwar nicht unwichtig, doch die Sicherheit steht klar im Vordergrund. Ob sich diese Haltung ändert? Vielleicht über viele Jahre, eher über Jahrzehnte.
Das ist problematisch, weil die gesetzliche Rente ja immer weniger ausreicht. Private Altersvorsorge ist unverzichtbar – eigentlich müsste der Berater die Kunden noch stärker davon abbringen, einseitig auf Garantien zu setzen.
Jaffke: Ganz genau. Entscheidend ist, dass der Kunde versteht: Die gesetzliche Rente allein wird die Versorgungslücke nicht schließen – sie wächst sogar weiter. Private Vorsorge schafft deshalb nicht nur Sicherheit, sondern auch Flexibilität. Wer früh anfängt, kann sich im Idealfall den Luxus eines früheren Renteneintritts leisten. Dafür ist entscheidend, dass Berater klar erklären, wie Rendite und Garantie ins Gleichgewicht gebracht werden können: Hohe Sicherheit verlangt höhere Beiträge aufgrund fehlender Chancen am Kapitalmarkt, wer stärker auf die Märkte setzt, kann mit weniger starten, muss aber Schwankungen aushalten. Hybridprodukte können hier Brücken bauen, sind jedoch erklärungsbedürftig. Ohne fundierte Beratung laufen Kunden Gefahr, bei Turbulenzen das Vertrauen zu verlieren – mit Stornos, die am Ende beiden Seiten schaden: den Kunden und dem Ruf der Branche.
Werfen wir einen Blick auf die Anforderungen an Versicherer und die Governance: Wie weit sind deutsche Versicherer heute in der Lage, ihre Produkte simulationsbasiert und regulatorisch belastbar zu bewerten – gerade bei fondsbasierten Tarifen mit komplexer Mechanik?
Jaffke: Wir sehen hier unterschiedliche Ansätze. Neben Anbietern wie Morgen & Morgen gibt es weitere externe Lösungen, die von Versicherern genutzt werden. Manche Gesellschaften bilden Simulationen in ihren aktuariellen Abteilungen selbst ab und holen sich punktuell externe Unterstützung. Andere arbeiten mit historisch gewachsenen Modellen, wie etwa unserem Volatium-Modell. Darauf aufbauend geben sie komplette Analysen in unsere Hände oder nutzen unsere Datenauswertungen als Grundlage für eigene Berechnungen. Insgesamt zeigt sich: Die Mehrheit der Versicherer greift heute auf am Markt etablierte Modelle zurück. Wichtig ist dabei, dass es sich um anerkannte Verfahren handelt, die auch bei der BaFin im Genehmigungsprozess Bestand haben.
Die Governance-Funktion muss Kapitalanlage, Zielmarkt und Produktgestaltung ganzheitlich steuern. Wie gelingt das in der Praxis – und speziell bei dynamischen Hybridlösungen?
Jaffke: Die jüngsten Veröffentlichungen der BaFin zeigen, dass es hier noch Defizite gibt – besonders bei dynamischen Hybridlösungen. Leistungen werden oft über klassische Hochrechnungen mit drei, sechs oder neun Prozent dargestellt. Dabei bleibt unklar, in welchem Topf das Geld zu welchem Zeitpunkt tatsächlich liegt: in Fonds, im Sicherungsvermögen oder in Rentenpapieren. Stattdessen wird linear hochgerechnet, obwohl Börsen nie linear verlaufen, sondern schwanken. Diese Realität lässt sich nur mit Simulationsmodellen erfassen. Sie zeigen, wie sich Marktschwankungen und die Verteilung der Anlagen tatsächlich auswirken – und ermöglichen erst eine belastbare Renditeaussage. Genau das ist der Knackpunkt bei dynamischen Hybridprodukten.
Bei den Produktfreigabeprozessen folgen viele Versicherer noch klassischen Ertrags- und Vertriebszielen. Was muss sich strukturell ändern, damit Value for Money zu einem echten Governance-Kriterium wird?
Jaffke: Ertrags- und Vertriebsziele sind für jedes Unternehmen unverzichtbar, daran ist nichts Negatives. Versicherungsprodukte müssen schließlich aktiv verkauft werden. Aber langfristig sollten diese Ziele so ausgerichtet sein, dass Versicherer bewusst das Geschäft anstreben, das sie wirklich wollen: Kundengruppen mit höherem Vertragsvolumen und größerer Bestandsfestigkeit, also geringeren Stornoquoten. Kurz: Klasse statt Masse. Der Weg führt weg vom reinen Produktverkauf, hin zu qualifizierter Beratung. In der betrieblichen Altersvorsorge zeigt sich das bereits: Spezialisierte Makler fordern simulationsbasierte Berechnungen, weil Unternehmen belastbare Renditeaussagen für ihre Mitarbeiter erwarten. Diese Ansätze lassen sich auch gut auf das Privatkundengeschäft übertragen – wenn Versicherer Beratung und nachhaltige Kundenbeziehungen konsequent in den Mittelpunkt stellen.
Vermittler sind ein zentrales Bindeglied. Sie müssen die Komplexität gegenüber den Kunden erklären. Wie verändert sich ihre Rolle in diesem neuen Regulierungsrahmen?
Jaffke: Früher haben Versicherer viel Verantwortung an die Vermittler delegiert – etwa bei Protokollen oder Dokumentationen. Beschwerden oder Verfahren wurden meist zuerst beim Vermittler geprüft: Was wurde gesagt, wie festgehalten? Viele Pflichten wurden so auf den Vermittler deligiert. Heute ist das anders: Versicherer stehen stärker in der Verantwortung. Gleichzeitig müssen sich Vermittler intensiver mit komplexeren Produkten und Regularien befassen. Beide Seiten sind gefordert. Weiterbildung, Schulungen und Vertriebsunterstützung sind entscheidend, damit die neuen Anforderungen erfüllt werden. Versicherer müssen nicht nur Produkte liefern, sondern deren Funktionsweise verständlich erklären. Für Vermittler entsteht so eine neue Qualität der Ausbildung – und für Kunden mehr Transparenz.
Seite 2: „Es gibt immer noch viele Versicherer, die im klassischen Produktverkauf verharren“