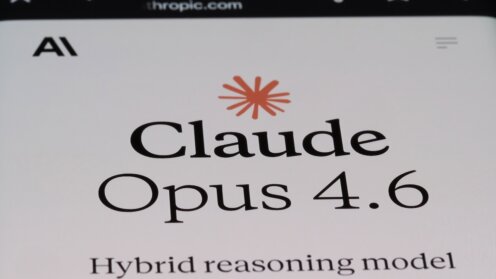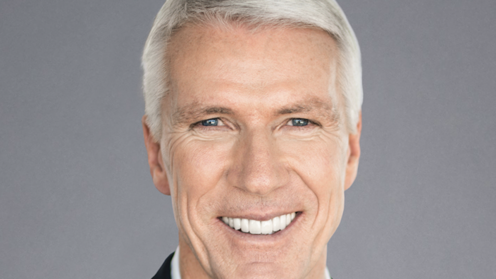Am Jahreswechsel gehört sie zum Inventar wie Fondue und Feuerzangenbowle: die Jahresprognose der Investmenthäuser. Akteure von der Wall Street bis Frankfurt überbieten sich mit Tabellen, Charts und „strategischen“ Thesen und wissen gleichzeitig: Die Trefferquote ist kaum besser als die des Wetterberichts für Januar. Warum hält sich diese Tradition dennoch, obwohl – anders als beim Fondue – alle ihren Sinn bezweifeln?
Das liegt weniger am Erkenntnisinteresse als an der Marktdynamik. Für Research-Abteilungen gilt: Bei allgemeinen Vorhersagen muss der Anlageexperte dabei sein. Andernfalls könnte das Publikum denken, die Zukunft sei ihm egal. Oder schlimmer: Niemand interessiere sich für seine Meinung. Wer zum Jahreswechsel keine Prognose veröffentlicht, signalisiert Relevanzverlust. Also wird publiziert, auf Teufel komm raus.
Erstaunlich ist bei den Prognosen: Sie klingen meist ziemlich einheitlich. Das gilt auch für das vor uns liegende Jahr. Trotz allgemein beklagter „Unsicherheit“ herrscht bemerkenswerter Konsens: rund 2,5 Prozent globales Wachstum, „solide“ Aussichten für US- und Schwellenmärkte, moderate Lockerung der Geldpolitik. Europa profitiert von Staatsausgaben für Rüstung und Infrastruktur, während KI und Produktivitätsfantasien als Storyline durch die Reports geistern. Risiken? Natürlich geopolitisch und fiskalisch, aber weitgehend eingepreist. Nur bei KI ist die Luft dünn geworden.
Dass viele Ausblicke einander weitgehend gleichen, ist kein Zufall: Denn alle stützen sich auf ähnliche Modelle, Annahmen und Datensätze. Hinzu kommt der Hang zur Extrapolation – man verlängert den Trend des vergangenen Jahres und nennt das Zukunft. Strukturelle Brüche, politische Schocks oder technologische Sprünge bleiben oft außen vor. Und weil niemand zu stark vom Konsens abweichen will, schauen sich alle Prognostiker gegenseitig über die Schulter. Ein Paradebeispiel für Herdenverhalten.
Ein weiteres Problem: Um die flüchtige Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen, werden die Prognosen oft als punktgenaue Ziele präsentiert. Das wirkt knackig. Headlines wie „S&P 500 steigt acht Prozent“ klingen nach Gewissheit, verschleiern aber, dass solche Werte bestenfalls ein Szenario unter vielen repräsentieren. Es ist die Illusion der Präzision. Exaktheit täuscht Gewissheit vor. Dabei ist die Zukunft kein Punkt, sondern ein Raum voller Möglichkeiten.
Wer langfristig investiert, braucht daher weniger Prophezeiung, mehr Prozess. Ein klar definierter, regelbasierter Ansatz kann besser mit Unwägbarkeiten umgehen als eine Jahreszahl, die im März schon veraltet ist. Das Einzige, was sicher ist, ist die Unsicherheit und daher die Fehlprognose. Worauf es daher ankommt, sind Szenarioplanung, Risikosteuerung und konvexe Strategien – also Set-ups, die auf verschiedene Entwicklungen reagieren können. Wirklich hilfreiches Research zeichnet sich durch Transparenz über Annahmen und Wahrscheinlichkeiten aus. Anleger sollten nicht nach dem einen Ziel suchen, sondern die Bandbreite potenzieller Entwicklungen verstehen: wie hoch, wie wahrscheinlich, wie verknüpft. Ein Plan A reicht selten – gefragt sind auch Plan B und C.
Jahresprognosen bleiben dennoch beliebt – weil sie Geschichten erzählen, Orientierung vorgaukeln und den Jahresauftakt strukturieren. Am Ende sind sie das, was Blicke in die Glaskugel immer waren: interessant, vielleicht lehrreich, wenn man sie nicht zu ernst nimmt. Auch bei der Feuerzangenbowle sollte man nicht zu tief ins Glas schauen.
Autor Thorsten Fischer ist Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM.