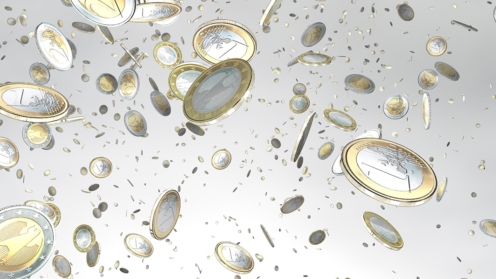Wir haben im Jahr 2024 durch Überschwemmungen binnen weniger Wochen enorme Schäden in Bayern und Baden-Württemberg gesehen. Sind wir ausreichend auf künftige Extremwetterlagen vorbereitet?
Käfer-Rohrbach: Die einfache Antwort lautet: Nein, wir sind nicht vorbereitet. Als Versicherungswirtschaft sehen wir die Folgen des Klimawandels längst in unseren Zahlen. Die Häufigkeit und Höhe von Schäden durch Extremwetter – etwa Hagel, Sturm, Starkregen und Überschwemmungen – haben in den letzten 20 bis 25 Jahren deutlich zugenommen. 2023/24 war mit den Weihnachtshochwassern in Niedersachsen und Bayern besonders heftig. Das Problem: Klimafolgenanpassung und Prävention sind nicht ausreichend verankert. Weder in der Politik noch in der Bauplanung. Noch immer entstehen jährlich rund 1.500 Neubauten in amtlich ausgewiesenen Hochwasserzonen. Das ist kontraproduktiv. Wir brauchen mehr Klimaschutz und mehr Vorsorge.
Obermayer: Im letzten Jahr hatten wir das Weihnachtshochwasser und dann im Sommer den Jahrhundertniederschlag und die Jahrhundertflut. Wenn man sich überlegt, was das Wort Jahrhundert eigentlich bedeutet – wir benutzen das inzwischen inflationär. Dabei bedeutet Jahrhundert ja, dass eine Wiederkehrwahrscheinlichkeit von über 100 Jahren gegeben ist. Das zeigt, wie stark sich das Klima verändert. Gleichzeitig stellt sich die Frage: Wer übernimmt die enormen Schäden, die dadurch entstehen? Und wie wollen wir als Gesellschaft künftig mit diesen Risiken umgehen?
Klug: Nach meinen Zahlen sind die Schäden in den letzten 20 Jahren um insgesamt 75 Prozent gestiegen, das sind im Schnitt rund drei Prozent mehr pro Jahr. Das ist enorm. Und wir reden nicht erst seit gestern darüber, sondern seit vielen Jahren. Trotzdem kommen wir kaum voran. Das eigentliche Problem ist: Niemand trifft Entscheidungen, niemand übernimmt Verantwortung. Und das gilt für alle – nicht nur für Versicherer, Politik oder Kommunen. Auch Verbraucher tragen ihren Teil der Verantwortung. Aber in allen Bereichen passiert schlicht zu wenig.
Billerbeck: Die Wissenschaft hat uns schon vor 20 Jahren gewarnt, heute zahlen wir die Rechnung. Die Zahl der Extremwetterereignisse nimmt spürbar zu, gleichzeitig macht uns die Schadeninflation große Sorgen. Wir beobachten im Markt erste Einschränkungen bei Deckungen und spürbare Kapazitätsprobleme – ein Trend, der sich seit zwei bis drei Jahren verstärkt. 2023 lagen die Schäden allein im Sachbereich wieder bei 5,6 Milliarden Euro. In meinem Bundesland Niedersachsen ist die Elementarschadenversicherungsquote besonders niedrig, weil viele glauben, sie seien nicht betroffen. Die wenigen, die versichert sind, haben im Grunde schon die gesamte Jahresprämie aufgebraucht. Das treibt die Prämien massiv nach oben. Und wir müssen uns natürlich auch Fragen lassen: Können wir als Branche überhaupt noch ausreichenden Versicherungsschutz bieten? Hier ist die Versicherungswirtschaft gefordert, ausreichend Deckungskapazitäten bereitzustellen. Prävention bleibt dabei ein zentrales Thema, darüber müssen wir intensiv sprechen.
In Niedersachsen besitzen 35 Prozent der Wohngebäudeversicherten ein Elementarschadenversicherung, in Schleswig-Holstein sind 41 Prozent. Bundesweit liegt die Quote bei 54 Prozent. Wie lässt sich das ändern?
Billerbeck: Wenn man als Vertreter der Versicherungsmakler Kritik äußert, sollte man auch selbstkritisch sein. Wir haben in unserem Maklerunternehmen in Niedersachsen unsere Absicherungsquote bei Elementarschäden geprüft: Die liegt dort 84 Prozent. Das Thema wird aktiv angegangen, auch im BDVM. Dennoch bleibt es eine Beratungsfrage, und die Branche muss hier besser werden. Viele unterschätzen das Risiko. In Niedersachsen etwa glauben viele, eine Flut wie im Ahrtal sei wegen der flachen Topografie unmöglich. Ein Trugschluss. Es braucht mehr Aufklärung. Denn wer sich nicht gefährdet fühlt, verzichtet oft auf Versicherung. In Köln weiß jeder: Der Keller läuft alle zehn Jahre voll. In Niedersachsen war das bislang kein Thema – das ändert sich. Die Quote lag vor Kurzem noch bei 24 Prozent und ist stark gestiegen. Auch die Landespolitik wirbt inzwischen für den Schutz. Aber die Trägheit bleibt ein Hindernis.
Frau Klug, was erleben Sie auf Seiten der Verbraucherzentrale?
Klug: Viele Verbraucher glauben, mit ihrer Wohngebäudeversicherung umfassend geschützt zu sein – ohne zu wissen, dass oft entscheidende Lücken bestehen. Besonders in Hamburg und Schleswig-Holstein ist das ein Problem. Die größte Gefahr ist hier nicht die Flussüberschwemmung, sondern die Sturmflut. Diese kann allerdings nicht versichert werden. Viele denken: „Warum absichern? Schneelawinen, Erdbeben haben wir nicht und Sturmflut ist eh ausgeschlossen.“ Das schafft Unsicherheit, etwa wenn unklar ist, ob eine Ostsee-Sturmflut als Überschwemmung gilt. Hinzu kommt das Gefühl: „Mich trifft es nicht.“ Doch auch in Hamburg gibt es Hanglagen – Erdrutsche sind möglich. Studien zeigen: Viele glauben, ausreichend geschützt zu sein, auch weil der Staat bislang oft geholfen hat. Echte Eigenverantwortung wurde kaum entwickelt. Hier braucht es mehr Bewusstsein – und besseren Versicherungsschutz.
Obermayer: Ich würde gern einen Schritt zurückgehen, weg von der Frage der Verantwortlichkeit, hin zu dem, was wirklich hilft. Aufklärung ist dabei zentral. Es geht auch um Beratung: Bin ich wirklich ausreichend abgesichert? Im Ahrtal ist das Bewusstsein heute hoch, aber viele wissen nicht, dass etwa der Bayerische Wald in derselben Starkregen-Risikozone liegt. Wo steht meine Immobilie, wie hoch ist mein Absicherungsbedarf, muss die Frage sein? Auch im Norden, wie Frau Klug es sagte, ist es oft schwer, Kundinnen und Kunden zu überzeugen. Deutschlandweit gibt es massive Aufklärungslücken. Viele wissen nicht, in welches Risiko sie gerade ihr gesamtes Vermögen investieren. Genau deshalb ist Aufklärung so entscheidend.
Käfer-Rohrbach: Seit Anfang der 2000er erfassen wir als Versicherer die Absicherung gegen Elementargefahren. Damals lag die bundesweite Versicherungsquote bei nur 19 Prozent, heute bei rund 56 Prozent. Die Bewegung kommt vor allem aus dem Neugeschäft: Viele Versicherer bieten Elementarschutz inzwischen standardmäßig an, und er wird auch abgeschlossen. Die eigentliche Herausforderung liegt im Bestand. Besonders unterschätzt wird Starkregen. Wer an einem Fluss wohnt, erkennt das Überschwemmungsrisiko oft sofort. Aber dass ein vollgelaufener Keller auch ohne Fluss vor der Tür drohen kann, ist vielen nicht bewusst. Diese neuen klimatischen Realitäten erreichen viele Köpfe noch nicht – nach dem Motto: „Ich wohne hier seit 30 Jahren, da war nie was.“ Genau das ist das Problem. Was wir brauchen, ist ein ganzheitlicher Ansatz: Hausbesitzer müssen ihre Eigenverantwortung erkennen, etwa bei Bauvorhaben in Risikozonen. Gleichzeitig müssen Bund, Länder und Kommunen in die Pflicht genommen werden. Und wir brauchen mehr Transparenz. Deshalb setzen wir uns für ein zentrales Naturgefahrenportal ein, das zeigt: Wo steht mein Haus und wie hoch ist mein Risiko?
Obermayer: Zur geringen Durchdringung im Bestand: Viele Altverträge bleiben unangetastet, weil jede Änderung meist einen komplett neuen Vertrag mit neuen Bedingungen und höherer Prämie nach sich zieht. Es geht also nicht nur um den zusätzlichen Elementarschutz, sondern um ein ganzes Paket – und das schreckt viele ab. Ein interessanter Vergleich ist Baden-Württemberg mit 94 Prozent Absicherungsquote. Das geht auf die frühere Pflichtversicherung zurück – ursprünglich wegen Erdbebenrisiken, nicht wegen Starkregen. Heute spricht kaum noch jemand über Erdbeben – ein Zeichen, wie sich Risiken und Klimabewusstsein verändert haben.
Warum gibt es für Sturmfluten keine Rückversicherungsansätze? Der Meeresspiegel steigt, Sturmfluten werden häufiger, allein die Sturmflut in Schleswig-Holstein hat knapp 400 Millionen Schaden verursacht.
Käfer-Rohrbach: Mit Blick auf unsere Nachbarländer zeigt sich: Sturmfluten sind privatwirtschaftlich kaum versicherbar. Weder die Niederlande noch andere Meeresanrainer bieten hier private Lösungen. Deichbau und Küstenschutz sind staatliche Hoheitsaufgaben. In Ländern wie den Niederlanden, die großteils unter dem Meeresspiegel liegen, greift der Staat automatisch ein, wenn es zu einer Sturmflut kommt. Wir müssen das Thema Sturmflut intensiver diskutieren. Eine Versicherung allein – ob privat oder in Public-Private-Partnership – reicht nicht aus. Entscheidend ist die staatliche Verantwortung für den Küstenschutz. An der Nordsee sehen wir, wie gut das funktionieren kann – dort sind die Deiche stark und der Schutz ist Teil staatlicher Planung.

Doch auch für eine mögliche Versicherungslösung braucht es verlässliche Daten: Wie werden die Deiche künftig angepasst? Was planen die Länder? An der Ostsee, wo es jüngst ebenfalls zu schweren Sturmfluten kam, stellt sich die Lage anders dar. Hier sind die Schutzgrade niedriger und man sieht buchstäblich das Meer im Vorgarten. Es bräuchte vermutlich zwei getrennte Sturmflutmodelle für Nord- und Ostsee. Doch diese Modellierung ist aufwendig, teuer und datenintensiv. Erst dann lässt sich beurteilen, ob eine privatwirtschaftliche Versicherung überhaupt möglich ist – oder ob es eine gemeinsame Lösung braucht. In der Debatte um eine Versicherungspflicht müssen wir Sturmfluten unbedingt mitdenken.
Nach Katastrophen sehen wir kurzzeitig ein steigendes Interesse am Versicherungsschutz. Herr Billerbeck, warum gelingt es nicht, das Bewusstsein dauerhaft zu verankern?
Billerbeck: Das Problem liegt weniger im Neugeschäft als im Bestand. Der Elementareinschluss macht inzwischen etwa 30 bis 35 Prozent der Prämie aus – das ist ein spürbarer Anteil. Nehmen wir Baden-Württemberg als Beispiel: Dort galt bis 1994 eine Pflichtversicherung, und noch heute liegt die Absicherungsquote bei 94 Prozent. Nur sechs Prozent sind ausgestiegen – ein deutliches Zeichen dafür, dass einmal eingeführter Schutz meist dauerhaft bleibt. Das ursprünglich abgesicherte Risiko war Erdbeben, aber die Risikolandschaft hat sich verändert. Dennoch: Wir könnten viel tun. Ein Opting-Out-Verfahren im Neugeschäft ist längst gängige Praxis, gerade im Maklerbereich. Schon aus Haftungsgründen müssen wir nachweisen können, dass ein Kunde bewusst auf den Schutz verzichtet hat. Kann man das nicht belegen, haftet der Makler. Insofern ist das Vorgehen hier oft strenger als in anderen Vertriebswegen. Ein sinnvoller Hebel wäre auch, auf jeder Beitragsrechnung klar zu kennzeichnen, wenn kein Elementarschutz besteht. So würden Versicherte regelmäßig daran erinnert. Am Ende aber bleibt Aufklärung entscheidend. Kommunikation ist der Schlüssel – und die steigende Quote zeigt, dass sich etwas bewegt.
Was hält der Verbraucherschutz von den Vorschlägen.
Klug: Bei der Idee „Info auf jeder Beitragsrechnung“ habe ich innerlich die Luft angehalten. Aufklärung hat viel bewirkt – die Versicherungsquote ist gestiegen –, aber weiter kommen wir so nicht. Die Leute lesen das nicht. Sie zahlen per Dauerauftrag, legen die Rechnung weg – fertig. Werbung? Verpufft. Information allein reicht nicht mehr. Opt-out-Modelle im Neugeschäft sind gut, aber riskant: Wenn zu viele rausoptieren, wird es unplanbar. Wir brauchen möglichst viele Versicherte, um zunehmende Gefahren wie Sturmfluten abzusichern. Ein weiteres Problem, das kaum diskutiert wird, betrifft auch den Norden: langanhaltender Nieselregen. Kein klassischer Starkregen, aber mit Folgen – gesättigte Böden, steigendes Grundwasser, vollgelaufene Keller. Und Grundwasser ist meist nicht mitversichert. Auch das müssen wir mitdenken. Die Entwicklungen zeigen klar – Information allein bringt uns nicht weiter. Wir brauchen breitere, tragfähigere Lösungen.
Obermayer: Der Mensch ist ein Verdrängungstier, das hilft ihm, in dieser komplexen Welt überhaupt klarzukommen. Genau das sehen wir auch in anderen Bereichen, etwa bei der privaten Pflegeversicherung: Alle um einen herum werden zum Pflegefall, nur man selbst nicht. Trotzdem bin ich überzeugt, Frau Klug: Ohne Aufklärung kommen wir nicht weiter. Sie muss früh ansetzen – idealerweise schon in der Schule – und Menschen durch alle Lebensphasen begleiten. Spätestens beim Hausbau braucht es verpflichtende Beratung. Ziel sollte sein, dass der Bauherr versteht, wo er da eigentlich baut. Vielleicht braucht es künftig einen Gebäudeausweis, mehr Transparenz und individuelle Präventionsmaßnahmen – damit der Kunde besser informiert ist als heute.
Billerbeck: Ich würde gerne nochmal an Frau Klug anschließen. Der Hinweis auf der Rechnung ist kein Allheilmittel, aber ein Baustein. Im Neugeschäft ist Elementarschutz heute meist ohnehin enthalten, weil Banken ihn beim Hausbau fordern. Aufklärung bleibt wichtig, keine Frage. Aber bei allem Verständnis für mehr Schutz sollten wir vorsichtig sein: Wenn wir auch Wassereintritt durch Bodensättigung oder Risse mitversichern wollen, müssen wir fragen, ob die Gebäudeversicherung dann noch bezahlbar ist. In den USA zahlt man in Risikogebieten wie New Orleans teils 10.000 Dollar Versicherungsprämie im Jahr, bei einem Gebäudewert von 500.000 Dollar. Wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass die Prämien bezahlbar bleiben müssen.
Sie haben es eben ja gesagt, die Schadenkostenquoten steigen, die Versicherungsprämien steigen, auch die Rückversicherer erhöhen die Prämien. Welche Folgen hat das langfristig?
Käfer-Rohrbach: Bezahlbarkeit und Versicherbarkeit von Elementarschäden sind die zentralen Fragen, die wir ehrlich diskutieren müssen. Dafür braucht es ein System, das langfristig und nachhaltig funktioniert. Prämien müssen risikobasiert und risikoadäquat kalkuliert werden – das fordert nicht nur die Aufsicht, es ist auch wichtig für die Finanzmarktstabilität. Steigende Schäden führen zwangsläufig zu steigenden Prämien – das ändert sich auch nicht, wenn mehr Menschen versichert sind. Es ist ein Irrglaube, dass die Prämien sinken, nur weil mehr Verträge abgeschlossen werden. Wenn vorher ein Haus in einer Straße versichert war und nun drei, wird es dadurch nicht billiger. Wir als Versicherer bewerten das individuelle Risiko des einzelnen Gebäudes und berechnen darauf basierend den Preis.
Und damit sind wir beim Thema Bezahlbarkeit.
Käfer-Rohrbach: Zuerst müssen wir klären, was „bezahlbar“ eigentlich heißt. Rund 95 Prozent der Häuser in Zürs-Zone 1 und 2 oder Starkregenzone 1 lassen sich für wenige Hundert Euro jährlich absichern. Die Debatte betrifft 1,5 bis zwei Prozent der Gebäude in Zone 3 und 4 – dort können Prämien teilweise vierstellig werden. Das ist die eigentliche Herausforderung. Das wird in der Politik oft als zu teuer empfunden, obwohl es um das Investment des Lebens geht – dem eigenen Haus. Zum Vergleich: Für ein altes Auto mit jugendlichem Fahrer zahlt man schnell 2.000 Euro im Jahr. Der Schutz ist da, aber das System muss tragfähig bleiben. Nur an der Versicherungsschraube zu drehen, reicht nicht. Wir sind auf Extremwetter nicht vorbereitet. Es braucht massive Investitionen in Prävention. Und wir müssen klären, wie Höchstschäden abgedeckt werden. Andere Länder nutzen Stop-Loss-Modelle – ab einem bestimmten Schaden springt der Staat ein. Sonst droht uns das, was Kalifornien oder Griechenland erleben: Dort sind bestimmte Risiken nicht mehr versicherbar. Wenn wir das System gefährden, riskieren wir den gesamten Gebäudeschutz. Es braucht einen ganzheitlichen Ansatz.
Billerbeck: Wir als Verband stellen uns die Frage, ob auf die Elementarschadenversicherung überhaupt Versicherungssteuer erhoben werden muss. Wir fordern hier eine Reduzierung oder idealerweise die Abschaffung. Denn der Staat kassiert doppelt: Einmal 19 Prozent auf die Prämie und dann erneut 19 Prozent Umsatzsteuer bei der Schadensbehebung. Wenn Elementarschäden existenzielle Risiken darstellen, sollte man – wie bei der Kranken- oder Lebensversicherung – auf die Steuer verzichten. Das würde die Prämien um fast 20 Prozent senken und wäre ein spürbarer Beitrag zur Bezahlbarkeit. Ich teile außerdem den Punkt von Frau Käfer-Rohrbach: Wir müssen aufpassen, dass Elementarschutz versicherbar bleibt.

Aktuell bieten wir meist Neuwertdeckung, das ist nicht in jeder Situation gerecht. Menschen in Risikogebieten wie am Rhein haben gelernt, mit der Gefahr zu leben. Sie treffen Vorsorge, räumen rechtzeitig aus, der Schaden ist oft nicht existenziell. Darum sollten wir auch über höhere Selbstbehalte nachdenken. Die heute üblichen 500 Euro oder zehn Prozent sind in vielen Fällen nicht mehr zeitgemäß.
Klug: Die Verbraucher und Verbraucherinnen benötigen vor allem Schutz vor finanziell existenzbedrohenden Risiken und nicht unbedingt die Graffiti-Entfernung an der Hauswand in der Wohngebäudeversicherung. Deshalb wäre es sinnvoll, einen klaren Kernschutz zu definieren: Was ist unbedingt nötig, um das Wohnen nach einem Schaden wieder zu ermöglichen? Alles darüber hinaus könnte optional zubuchbar sein. Ein solcher Basisversicherungsschutz, kombiniert mit höherer Selbstbeteiligung, wäre ein pragmatischer Weg. Ebenso könnte man überlegen, eine Deckelung einzuführen – mit einer staatlichen Absicherung oberhalb einer gewissen Schadenshöhe. Zudem ließe sich die Eigenverantwortung der Kunden stärker einbeziehen: Obliegenheiten wie eine funktionierende Rückstauklappe ist sicherlich das Mindeste. Auch bauliche Maßnahmen wie Schutzwälle könnten Voraussetzung für Versicherungsschutz sein. Ich denke, dass da schon Spielraum besteht, den Verbraucher mehr in die Verantwortung zu nehmen, um dann eben den Versicherungsschutz weiter aufstellen zu können. Es geht darum, die Verantwortung zwischen Versichertem, Versicherer und Staat fair zu verteilen, für einen tragfähigen und bezahlbaren Schutz.
Käfer-Rohrbach: Das Problem ist, wir haben teilweise sehr alte Versicherungsverträge im Bestand – viele sind 30 Jahre alt. Wenn man nun Elementarschutz anbündeln will, muss man oft den gesamten Vertrag anfassen. Genau da beginnt die Schwierigkeit: Der Kunde sieht, dass mit neuen Vertragsbedingungen eventuell höhere Beiträge fällig werden – selbst bei einem klar definierten Kernschutz. Und dann lehnt er das Angebot ab und sagt, ich bleibe beim alten Vertrag. Und hier greift die Vertragsfreiheit. Viele verstehen nicht, warum Bestandskunden nicht einfach umstellen. Aber es liegt an diesen alten Verträgen, bei denen jede Änderung schnell zur Ablehnung führt.
Obermayer: Bei uns gibt es ein Produkt namens Elementar Solo, das als eigenständiges Modul an jeden bestehenden Wohngebäudevertrag angedockt werden kann – unabhängig vom Versicherer. Damit umgehen wir das Problem, dass man den kompletten Vertrag umstellen müsste, und ermöglichen trotzdem eine Elementarabsicherung. Für Gebäude in den Zürs-Zonen 1 und 2 liegt die Prämie bei rund 120 bis 140 Euro im Jahr – das wäre für viele ein praktikabler Einstieg. Zur Frage nach künftigen Preismodellen: Eine Staffelung der Prämie nach Präventionsgrad halte ich für sinnvoll. Viele Maßnahmen kosten wenig – ein gefliester Keller oder regelmäßige Dichtigkeitsprüfungen. Wenn wir solche Maßnahmen honorieren, können wir auch mutiger versichern, statt immer nur über Ausschlüsse zu reden. Denn für Kundinnen und Kunden ist ein Ausschluss oft schwer nachvollziehbar, gerade wenn dieser aus einem Beratungsgespräch stammt, das 30 Jahre zurückliegt. Es wäre wünschenswert, wenn Versicherer klar sagen: Wir sind für dich und dein Haus da. Und nicht erst nach einem Blick in Bedingungspunkt A.1.4.5.
Frau Käfer-Rohrbach Sie sagten gerade, es gäbe teilweise 20, 30 Jahre alte Verträge in den Beständen. Herr Billerbeck, sind die Maklerinnen und Makler gefordert, bei ihren Kunden den Versicherungsbestand kontinuierlich unter die Lupe zu nehmen. Denn im Zweifelsfall gehen die Kunden voll in Risiko.
Billerbeck: Wenn ein Vertrag 30 Jahre lang nicht angerührt wurde – bewusst oder unbewusst – ist das eigentlich ein Unding. Wir Makler prüfen regelmäßig, aber manchmal heißt es: „Bitte nichts ändern, sonst verdoppelt sich der Beitrag – und Elementar käme noch obendrauf.“ Das ist dann eine strategische Entscheidung, die gut dokumentiert sein sollte. Wir haben heute rund 84 Prozent Versicherungsquote. Für die übrigen 16 Prozent wäre ein strukturiertes Vorgehen sinnvoll – vielleicht sogar ein Wettbewerbsvorteil. Ich unterstütze Frau Klug: Wer nur Basis-Schutz hat, erinnert sich im Schadenfall nicht daran, dass er sich bewusst für das günstigste Produkt entschieden hat. Dann heißt es oft: „Warum hat mir das niemand gesagt?“ Hätte das bessere Produkt 200 Euro mehr gekostet, würden es viele rückblickend sofort nehmen. Beratung ist deshalb entscheidend. Unser Vorschlag: flächendeckendes Opt-out-Angebot im Bestand. Wer keinen Schutz will, muss aktiv widersprechen – und akzeptieren, dass es im Schadenfall keine staatliche Hilfe geben wird. Für Zone 3 und 4 braucht es Sonderlösungen. Aber die breite Masse in Zone 1 und 2 ist versicherbar. Dort müssen wir ansetzen.
Obermayer: Wir haben das Opt-out-Modell seit 2021 im Einsatz und erreichen damit eine Durchdringungsquote von über 90 Prozent. Deshalb kann ich mich Herrn Billerbeck nur anschließen.
Klug: Ich finde das Opt-out-Modell grundsätzlich in Ordnung. Meine Sorge ist nur: Wenn ich an den typischen Hamburger denke, der sagt „Ich bin doch in Zürs 1, was soll’s – ich steige aus“, dann frage ich mich, ob dadurch nicht am Ende eine zu große Lücke bei den Prämieneinnahmen entsteht. Das wäre problematisch, wenn viele diese Option nutzen. Ein klarer Riegel, wie Herr Billerbeck es vorgeschlagen hat – etwa: Wer sich bewusst gegen den Schutz entscheidet, bekommt im Schadenfall keine staatliche Hilfe –, könnte helfen. Das wäre sicher ein wirksames Signal. Aber ja, meine Befürchtung bleibt: Dass am Ende zu viele rausoptieren und das ganze System dadurch ins Wanken gerät.
Käfer-Rohrbach: Bisher hatten wir meist ein Opt-in-Modell – ein echtes Opt-out wäre da schon ein Fortschritt. Man könnte sagen: Ab Zeitpunkt X werden alle Bestandsverträge automatisch auf Elementarschutz umgestellt, es sei denn, der Kunde, die Kundin widerspricht aktiv. Damit würden wir vermutlich deutlich mehr Menschen erreichen, als wenn wir weiter nur auf freiwillige Zustimmung setzen. Das ließe sich auch politisch flankieren, etwa mit staatlicher Unterstützung. Entscheidend ist, wie Herr Billerbeck sagt: Solange sich jeder darauf verlassen kann, dass im Schadenfall der Staat einspringt – idealerweise noch im Wahlkampf mit Gummistiefeln und Versprechen –, fehlt der Anreiz zur Eigenvorsorge. Irgendwann muss der Staat sagen: Du hattest die Möglichkeit zur Versicherung und hast sie nicht genutzt – also gibt’s keine Hilfe mehr. Ob das dann auch konsequent durchgezogen wird, bleibt die große Frage. Aber genau das wäre der Hebel, der wirklich etwas verändern könnte.
Billerbeck: Exakt. Ich war letztes Jahr im Ahrtal – und dort sieht man sehr deutlich den Unterschied zwischen staatlicher Hilfe und Versicherungsschutz. Staatliche Hilfe ersetzt keinen Neuwert, sie ist nur eine Unterstützung. Wer durchs Ahrtal geht, erkennt sofort, wer versichert war und wer nicht. Trotz aller Kritik an der Branche und ihrer Überforderung: Der Nutzen einer Neuwertdeckung wird dort sehr sichtbar.
Seite 2: „Das französische Modell kommt hinten und vorne nicht zurecht“