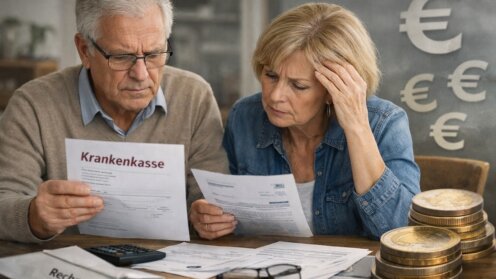Kaum ein Thema sorgt politisch zurzeit so zuverlässig für Schlagzeilen wie die „Rente mit 70“. Talkshows, Interviews, Parteitage – überall wird die Anhebung des Renteneintrittsalters als „Hauptschlüssel“ zur Zukunftsfähigkeit unseres Rentensystems gehandelt.
Mich stört das: Denn diese Debatte löst die akuten Probleme doch gar nicht. Bevor wir über die „Rente mit 70“ sprechen, muss die „Rente mit 67“ überhaupt einmal voll greifen. Eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters bringt kurz- und mittelfristig keine Entlastung für die Renten- und Krankenversicherung. Natürlich macht die demografische Entwicklung langfristige Anpassungen notwendig. Aber wer so tut, als ließe sich das Finanzierungsproblem der sozialen Sicherungssysteme mit einer Jahreszahl im Kalender lösen, lenkt von dringlicheren Fragen ab. Wir brauchen nicht noch mehr Symbolpolitik für 2070, sondern konkrete Entscheidungen für die Jahre 2026 bis 2028.
Die akute Schieflage: weit mehr als ein Rentenproblem
Die eigentliche Schieflage unseres Sozialstaats ist nicht theoretisch und nicht fern in der Zukunft. Sondern sie ist akut. Das gilt für die gesetzliche Rentenversicherung ebenso wie für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung. Und es gilt für den Bundeshaushalt, der mit immer höheren Steuerzuschüssen versucht, diese Systeme zu stabilisieren.
Mit anderen Worten: Es ist nicht nur die Rentenkasse, die stöhnt. Auch die Krankenkassen und die Pflegeversicherung geraten zunehmend unter Druck. Und der Staat versucht, alles mit immer neuen Milliarden zu überdecken, die an anderer Stelle fehlen. Diese Entwicklung ist auf Dauer nicht tragfähig, wenn Deutschland zugleich wettbewerbsfähig bleiben soll. Genau deshalb ist die Fokussierung auf das Renteneintrittsalter zu kurz gesprungen. Sie vermittelt Handlungsfähigkeit ohne die wirksamen, aber unbequemen Hebel anzupacken.
Drei Sofort-Hebel bis 2028
Wenn wir die soziale Sicherung und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stabilisieren wollen, müssen wir zuerst dort ansetzen, wo kurzfristig eine Entlastung möglich ist. Aus meiner Sicht gehören drei Maßnahmen auf die Prioritätenliste für die Jahre 2026 bis 2028.
1. Versicherungsfremde Leistungen ehrlich herausnehmen
In alle Sozialversicherungszweige sind im Laufe der Zeit Aufgaben hineingewachsen, die mit dem ursprünglichen Versicherungszweck nur noch wenig zu tun haben. Wir sprechen hier von versicherungsfremden Leistungen. Was politisch sicherlich gut gemeint war, führt heute zu einer Überlastung der Systeme. Diese Leistungen müssen ehrlich getrennt, offengelegt und – wo vertretbar – aus den Sozialversicherungen herausgenommen oder deutlich zurückgeführt werden. Sozialpolitik sollte transparent über den Staatshaushalt erfolgen, nicht versteckt in den Beiträgen der Beschäftigten und Arbeitgeber.
2. Unbezahlbares aus der Vergangenheit zurückdrehen
Zweitens müssen wir den Mut haben, auch Leistungen zu überprüfen, die über Jahre als unantastbar galten, die jedoch heute kaum noch finanzierbar sind. Dazu zählen beispielsweise die Mütterrente oder die vorgezogene abschlagsfreie Rente für langjährig Versicherte. Beides mag nachvollziehbare Motive gehabt haben. Zwar sind diese Entscheidungen politisch in Summe attraktiv, finanziell jedoch schwer tragbar. Wenn wir die Systeme stabilisieren wollen, kommen wir um eine ehrliche Überprüfung solcher Leistungen nicht herum. Mit dem klaren Ziel, das Gesamtniveau auf ein dauerhaft finanzierbares Maß zurückzuführen.
3. Wettbewerbsfähigkeit vor kurzfristige Wohltaten
Drittens muss uns klar sein, dass die Beitragshöhe zur Sozialversicherung kein isoliertes Thema ist. Hohe Lohnnebenkosten schwächen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und damit Wachstum, Investitionen und Beschäftigung in Deutschland. Wer immer neue Leistungsversprechen zulasten der Beitragszahler abgibt, löst daher nicht nur ein Sozial-, sondern auch ein Wirtschaftsproblem aus. Nur durch Eingriffe in die Leistung, so unpopulär sie kurzfristig auch sein mögen, können wir die gesamtwirtschaftliche Belastung senken und Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit stärken.
Was die Rente mit 70 leisten kann und was nicht
Sollten wir die Debatte um das Renteneintrittsalter also komplett beenden? Nein. Mittel- bis langfristig wird eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters unumgänglich sein. Wenn die Lebenserwartung steigt und wir dauerhaft mehr Rentenjahre finanzieren müssen, ist es logisch, dass sich auch die Lebensarbeitszeit verlängert.
Aber: Die genaue Ausgestaltung braucht Augenmaß. Es kann nicht jeder bis 70 im gleichen Umfang in seinem Beruf arbeiten, insbesondere nicht in körperlich besonders belastenden Tätigkeiten. Hier werden wir differenzierte Lösungen brauchen, die sowohl der Gesundheit der Menschen als auch der wirtschaftlichen Realität Rechnung tragen.
Hinzu kommt: Die Zu- und Abschlagsfaktoren in der gesetzlichen Rente passen nicht mehr zu den heutigen Lebensrealitäten. Wer länger arbeitet, muss erkennbar mehr Rente erhalten. Wer deutlich früher geht, muss realistischerweise mit spürbaren Abschlägen leben. Diese Logik ist für die meisten Menschen nachvollziehbar – wenn sie transparent und fair angewendet wird. Und: Ohne tiefgreifende Strukturreformen im Gesundheitswesen bleibt jede Rentenreform Flickwerk. Was wir heute sehen, sind vielfach nur kurzfristige Kompromisse, keine Strukturreformen, die diesen Namen im eigentlich ausgerufenen „Herbst der Reformen“ verdienen.
Aktivrente als Brücke: Arbeiten im Ruhestand lohnt sich
In diesem Kontext halte ich die Aktivrente für einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Sie setzt genau dort an, wo wir Potenzial haben: bei Menschen, die bereits das Renteneintrittsalter erreicht haben, aber noch arbeiten wollen und können.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Aktivrente wirkt dem Fachkräftemangel entgegen, indem erfahrene Mitarbeiter länger im Arbeitsleben bleiben. Sie stärkt diejenigen, die bereit sind, auch im Ruhestand Verantwortung zu übernehmen und sich einzubringen. Sie stabilisiert Renten- und Krankenversicherung, weil auch in dieser Phase zumindest teilweise Beiträge fließen. Vor allem aber setzt die Aktivrente ein wichtiges Signal: Leistung und Einsatz für die Arbeit werden auch im höheren Alter wertgeschätzt und nicht durch starre Regeln ausgebremst. Genau diese Haltung brauchen wir in einer alternden Gesellschaft.
Was mir Sorge bereitet, ist eher die Reaktion mancher Kritiker: Statt den gesamtwirtschaftlichen Nutzen zu sehen, wird reflexartig mit rechtlichen Bedenken und möglicher Ungleichbehandlung argumentiert. Natürlich müssen rechtliche Fragen sauber geklärt werden. Aber sie dürfen nicht dazu führen, dass eine sinnvolle Idee wieder zerredet oder blockiert wird.
Weiterarbeiten ohne Hürden
Wenn wir wollen, dass Menschen im Rentenalter weiterarbeiten, dann dürfen wir sie nicht mit denselben arbeits- und tarifrechtlichen Hürden konfrontieren wie Vollzeitkräfte im Erwerbsleben. Tarif- und arbeitsrechtliche Vorgaben sollten für Aktivrentner nicht in vollem Umfang gelten. Wir sollten diesen Menschen eine möglichst große Flexibilität einräumen – bei Arbeitszeit, Einsatzumfang und Vertragsgestaltung. Sonst schrecken wir genau diejenigen ab, die wir eigentlich gewinnen wollen.
Die Details können und sollten vielfach von den Tarifvertragsparteien oder im Rahmen von Betriebsvereinbarungen geregelt werden. Das Gesetz kann einen klaren, einfachen Rahmen setzen, der Raum für praxisnahe Lösungen vor Ort lässt. Entscheidend ist: Wer im Rentenalter weiterarbeiten möchte, sollte dies ohne unnötige Bürokratie und rechtliche Unsicherheit tun können.
Was ich von der Politik erwarte: Verantwortung statt Vertagung
Am Ende geht es um eine einfache, aber unbequeme Frage: Trauen wir uns, an die wirklichen Stellschrauben zu gehen? Oder vertrösten wir das Land weiter mit symbolträchtigen Debatten? Wer das System stabilisieren will, muss drei Dinge gleichzeitig aushalten: erstens ehrliche Eingriffe in das Leistungsniveau, wo es nicht mehr finanzierbar ist. Zweitens eine klare Priorität für Maßnahmen, die kurzfristig wirken und die Sozialkassen tatsächlich entlasten. Drittens eine langfristige Reformperspektive, in der Renteneintrittsalter, Zu- und Abschlagsfaktoren und das Gesundheitswesen zusammen gedacht werden. Das ist sicherlich erheblich anspruchsvoller zu erklären als eine neue Zahl im Rentengesetz. Es ist jedoch auch ehrlicher. Genau hier entscheidet sich, wie ernst es der Politik mit Verantwortung wirklich ist.
Die grundlegenden Reformen und Leistungskürzungen müssen endlich angegangen werden – auch wenn dies Wählerstimmen kostet. Hier muss die aktuelle Regierung endlich einmal Verantwortung für Deutschland übernehmen und nicht nur auf den nächsten Urnengang schielen. Wenn uns dieser Mut fehlt, wird das System für kommende Generationen unbezahlbar. Wenn wir ihn aufbringen, haben wir die Chance, die soziale Sicherung in Deutschland so zu erneuern, dass sie auch in einer alternden Gesellschaft tragfähig bleibt.
Der Autor Dr. Guido Bader ist CEO der Stuttgarter Lebensversicherung