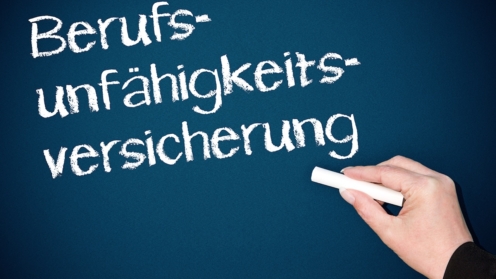Ein anderes Thema: Herr Kock, warum verzichtet HDI auf die konkrete Verweisung. Das hat im Markt für Kritik gesorgt. Und Herr Ressel, Herr Weigelt – wie handhaben Sie diesen Punkt?
Kock: Das Thema Verweisung ist eines der kompliziertesten in der BU überhaupt. Sobald man es aufmacht, geht es um abstrakte und konkrete Verweisung, Erst- und Nachprüfung – selbst Fachleute verlieren da schnell den Überblick. Wir haben uns deshalb bei der HDI Ego Top für einen klaren Schnitt entschieden: kein Verzichtstrick, sondern vollständiger Verzicht auf jede Form der Verweisung – in Erst- und Nachprüfung. Das wirft Fragen auf, ob das Kollektiv gefährdet wird. Unsere Antwort: Nein. Wir haben jahrzehntelange BU-Erfahrung, stabile Beiträge und eine solide Kalkulationsbasis. Für Kunden bedeutet das absolute Klarheit: Wer mindestens 50 Prozent berufsunfähig ist, erhält seine BU-Rente – egal ob er umschult, neu anfängt oder in einem anderen Beruf arbeitet. Für unsere Partner wird Beratung dadurch einfacher: Bei HDI gibt es keine Verweisung, Punkt. Oder anders gesagt: Wer in unseren Bedingungen nach dem Wort „Verweisung“ sucht, wird es nicht finden.
Ressel: Wir gehen hier einen anderen Weg. Auf die Prüfung einer möglichen Umorganisation verzichten wir zwar, aber nicht komplett. Bei Selbstständigen mit akademischem Abschluss oder Betrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern – wenn der Unternehmer überwiegend kaufmännisch tätig ist – sehen wir keinen Prüfbedarf. Der komplette Verzicht auf konkrete Verweisung und/oder Umorganisation, unterstützen wir nicht. Denn das kann dem Versichertenkollektiv massiv schaden und sich langfristig auf die Stabilität der Prämien und die Kalkulation nachteilig für den Versicherten auswirken. Franke und Bornberg ziehen dafür inzwischen sogar Punkte ab, weil diese Features als stabilitätsgefährdend gelten. Für uns steht deshalb die Balance zwischen Versicherbarkeit und Solidität im Vordergrund.
Weigelt: Wir sehen es ähnlich. Am Ende muss das Kollektiv funktionieren. Wenn man Leistungserweiterungen einführt, ohne sie sauber einzupreisen, entsteht ein Ungleichgewicht. Genau das haben wir an einigen Stellen am Markt wahrgenommen. Für uns ist das kritisch, denn die BU soll die Arbeitskraft gegen existenzielle Risiken absichern, nicht darüber hinaus. Wenn jemand noch Vollzeit in einem anderen Beruf arbeiten kann und trotzdem weiter BU-Leistungen erhält, mag das individuell erfreulich sein, widerspricht aber dem Grundgedanken des Produkts. Deshalb halten wir am Schutz des Kollektivs fest. Einen Verzicht auf die konkrete Verweisung könnten wir ohne entsprechende Kalkulation nicht anbieten – und genau diese Kalkulation würde am Ende den Preis verändern. Für uns gilt daher: existenzielle Risiken absichern, Kollektiv schützen, Verlässlichkeit wahren.
Kock: Ich möchte hier klar Position für den HDI beziehen. Über andere Anbieter urteile ich nicht – dafür gibt es Rater und Experten. Fakt ist: Wir haben eine der höchsten Annahmequoten und Leistungsquoten sowie eine der niedrigsten, weiter sinkenden Prozessquoten. Das zeigt, dass wir wissen, was wir tun. Der vollständige Verzicht auf jede Form der Verweisung seit 1. Januar 2024 ist aktuariell sauber kalkuliert. Auch bei „Ego Top Next Level“ gilt: Wir haben es durchgerechnet und sind sicher, dass es unser Kollektiv nicht gefährdet. Jede Gesellschaft muss sich solche Fragen stellen, sonst wäre es unseriös. Unser Ansatz reduziert Komplexität und vermeidet Streit: Bei Verweisungen entstehen oft Konflikte zwischen Kunden und Versicherern. Mit unserem Weg schaffen wir Klarheit und wir sind überzeugt, dass der HDI auch künftig so stabil am Markt auftritt wie in den vergangenen Jahrzehnten.
Die Grundfähigkeitsversicherung ist stark im Kommen. Wie entwickelt sich die Nachfrage bei Ihnen?
Weigelt: Wir haben zum Jahreswechsel viel bewegt und sehen 2024 eine enorme Steigerung der Nachfrage. Gleichzeitig entwickeln sich Produkte weiter – bei Zugangsvoraussetzungen oder Wechseloptionen – und wachsen bedingungstechnisch zusammen. Das bestätigt: Es geht um ganzheitliche Beratung, nicht um „entweder BU oder Grundfähigkeit“. Auch wer schon eine BU hat, kann durch eine Grundfähigkeitsversicherung sinnvoll ergänzen. Sie ist nicht nur für körperlich Tätige interessant, auch Akademiker profitieren von Schutz wichtiger Fähigkeiten. Für die Branche heißt das: mehr Transparenz und klare Vergleichsmöglichkeiten. Ratings wie Franke & Bornberg oder Morgen & Morgen helfen, Kriterien zu setzen und Vergleichbarkeit herzustellen. Jeder Kunde hat individuelle Bedürfnisse – genau deshalb erlebt die Grundfähigkeitsversicherung hohe Nachfrage und zeigt, wie wichtig gute Beratung ist.
Ressel: Wir spüren keine Nachfrage, weil wir keine Grundfähigkeitsversicherung (GF) anbieten. Stattdessen setzen wir auf die Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EU) als echte Alternative zur BU – sie deckt auch psychische Erkrankungen ab und bietet damit Vorteile gegenüber der GF. Bei Grundfähigkeit sehen wir Probleme in den engen Definitionen der AVB. Wer sie nach einer BU-Beratung als Alternative darstellt, bewegt sich schnell in einer Grauzone und riskiert Falschberatung, wenn Unterschiede nicht sauber dokumentiert sind. Aus meiner Sicht ist GF keine gleichwertige Alternative, weil sie nur bestimmte Fähigkeiten absichert und marketingtechnisch oft fälschlicherweise auf eine Stufe mit der BU gehoben wird.
Kock: Für mich ist die einzige echte Alternative zur BU eine BU. Punkt. Alles andere ist eine absurde Diskussion. Man kann BU-Tarife – HDI, Swiss Life oder Conti – vergleichen, aber nicht BU und Grundfähigkeit in einem Atemzug nennen. Auch nicht mit der Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die zwar näher dran ist, aber trotzdem etwas anderes absichert. Die BU schützt den Beruf und damit die Arbeitskraft. Die Grundfähigkeitsversicherung hingegen sichert einzelne Fähigkeiten ab – und genau darin liegt ihre Stärke. Mit unserem EGO Grundfähigkeitsschutz haben wir ein flexibles Bausteinkonzept entwickelt, das gezielt Fähigkeiten absichert, die für die Berufsausübung entscheidend sind. Wichtig ist, dass in der Beratung nicht suggeriert wird: „Wenn dir die BU zu teuer ist, nimm doch die Grundfähigkeit.“ Das wäre falsch. Die Grundfähigkeitsversicherung ist ein anderer Beratungsansatz, der sich an Kunden richtet, die keine BU wollen oder können, aber Schutz vor Einkommensverlust durch den Verlust wichtiger Fähigkeiten suchen. Sie ist keine BU light, sondern ein eigenständiges Produkt.
Nur wenige Anbieter fokussieren sich auf die Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EU). Sie gilt oft als einzige echte Alternative zur BU. Nun bieten zwei Versicherer die EU an, während ein anderer sich zurückgezogen hat. Warum?
Kock: Wir hatten eine EU im Angebot, haben uns dann aber für die Grundfähigkeitsversicherung entschieden. Die EU wurde nicht so angenommen, wie wir es erwartet hatten. Und da wir nicht mit drei Produktlinien parallel fahren wollten, haben wir uns entschieden, die Grundfähigkeitsversicherung neben der BU als zweite Lösung zu positionieren.
Weigelt: Wir haben über die Metallrente einen Erwerbsminderungstarif entwickelt, der auch gut funktioniert. Trotzdem sehen wir, dass die Hürden bei der Risikoprüfung oft ähnlich hoch sind wie bei einer BU. Wenn der Zugang sich so stark angleicht, stellt sich die Frage: Warum nicht gleich die BU? Deshalb haben wir die EU in der Branchenlösung nicht weiterverfolgt und setzen ergänzend ebenfalls auf die Grundfähigkeit.
Ressel: Es ist definitiv ein anderer Schutz. Oft wird die Grundfähigkeit als Ersatz für die BU positioniert. Wir sehen das kritisch. Wer nicht in die BU kommt, sollte besser in die EU gehen – dort ist man vor allem bei psychischen Erkrankungen abgesichert und vermeidet viele Detaildiskussionen im Leistungsfall. Die EU bleibt für uns die bessere BU-Alternative. Erst wenn auch diese nicht möglich ist, kommt die Grundfähigkeit ins Spiel. Was uns zudem auffällt: Viele Anbieter blähen die AVB künstlich auf, indem sie immer mehr Grundfähigkeiten hinzufügen – oft mit Überschneidungen. Uns geht es um Klarheit und eine solide Leistungsquote, nicht um aufgeblähte Kataloge.
Der Volksmund sagt, Versicherer zahlen eh nicht. Wie hoch sind Ihre Leistungsquoten? Und wie lange dauert es bis zur Entscheidung?
Kock: Unsere Leistungsquote liegt bei 86,73 Prozent – eine der besten im deutschen Markt und deutlich über dem Durchschnitt von 80,74 Prozent. Die Bearbeitungsdauer lässt sich schwer pauschal beantworten: Im Schnitt sind es 55 Tage, also rund acht Wochen. Das reicht von ganz klaren Fällen, die in zwei Tagen entschieden sind, bis hin zu komplexen Vorgängen, die über ein Jahr dauern können. Wichtig ist: Sobald alle Unterlagen vorliegen, entscheiden wir im Durchschnitt innerhalb von acht Tagen.
Weigelt: Am Markt reicht die Spanne der Quoten von rund 62 Prozent bis deutlich darüber. Wir liegen bei etwa 83 Prozent, also ebenfalls über dem Schnitt. Zur Bearbeitung: Manchmal warten wir drei Monate auf eine Arztrückmeldung – das verzögert natürlich den Prozess. Unser Rekord liegt bei unter einer Woche, von der Meldung bis zur Auszahlung. Stehen die Informationen bereit, geht es schnell.
Ressel: Mit unserer Quote von 74 Prozent, werden wir von Morgen & Morgen als ausgezeichnet eingestuft. Angesichts unseres starken Neugeschäfts ist das ein sehr guter Wert. Das zeigt, dass wir echte Fälle auch tatsächlich leisten – gleichzeitig prüfen wir streng bei betrügerischen oder ungerechtfertigten Anträgen, um das Kollektiv zu schützen. Das trägt zur Beitragsstabilität und Kundenzufriedenheit bei. Man muss allerdings bedenken: Für echte Vergleichbarkeit müsste man auch die Bestände der Versicherer betrachten. Wer viele Beitragsbefreiungen im Portfolio hat, weist naturgemäß eine höhere Quote aus. Unsere Bearbeitungsdauer hängt vom Fall ab und liegt im Durchschnitt bei etwa drei bis fünf Monate. Bei guter Aufbereitung aller relevanten Infos kann sofort entschieden werden.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung in den Prozessen – von Antrag über Risikoprüfung bis zum Abschluss? Und wie schnell geht es im Best Case vom Antrag bis zur Police?
Weigelt: Digitalisierung ist vor allem im Antragsprozess entscheidend. Es geht darum, schnell eine Einschätzung zur Versicherbarkeit zu bekommen. Ein gutes Beispiel ist Versdiagnose – ein Tool, das wir von Anfang an nutzen. Damit liegt die Policierungsquote bei 48 Stunden. Das ist ein klarer Vorteil für Kunden, Vermittler und Versicherer. In der Leistungsprüfung steckt noch viel Potenzial, gerade bei standardisierten Arztberichten. Aber am wichtigsten ist: Wie schnell erhält der Kunde eine Zusage? Und da sind wir mit den bestehenden Tools auf einem sehr guten Weg.
Ressel: Digitalisierung ist zweifellos ein elementarer Bestandteil des Geschäftsalltages geworden. Wir entwickeln uns hier stetig weiter und wachsen mit den Erwartungen der Kunden und Vertriebspartner mit, um deren Anforderungen einfacherer Prozesse gerecht zu werden. Wir unterscheiden in der Antragsprüfung zwischen Dunkelpolicierung und manueller Bearbeitung. Im Best Case dauert die Dunkelpolicierung drei Stunden, bei manuellen Fällen und sauber ausgefüllten Anträgen etwa 24 Stunden.
Kock: Der Idealfall läuft digital und ist sofort policiert. In der Regel gibt es vorher eine Risikovoranfrage – hier garantieren wir innerhalb von 48 Stunden ein Votum. Danach geht der Antrag direkt in die Policierung. Digitalisierung bringt überall dort Vorteile, wo Prozesse beschleunigt werden können – ohne die Beratung zwischen Vermittler und Kunde zu ersetzen. Ich glaube nicht, dass die BU jemals rein digital beraten wird.
Den Roundtable moderierte Jörg Droste, Ressortleiter Versicherungen Cash. & Cash.online
Dieser Artikel ist Teil des EXTRA Arbeitskraftabsicherung. Alle Artikel des EXTRA finden Sie hier.