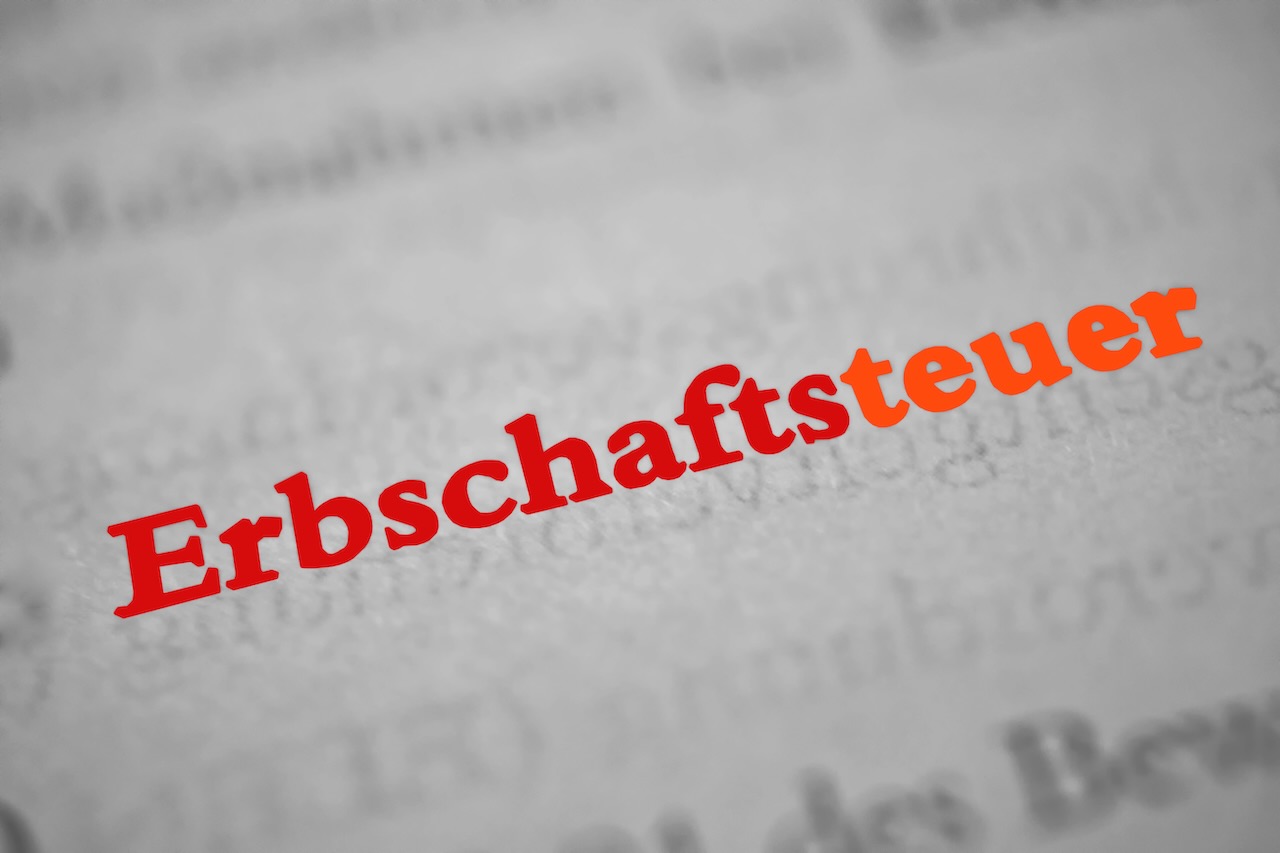Das Internetportal „Die Erbschützer“ stellt sieben Urteile vor, mit deren Hilfe sich die Erbschaftsteuer auf Null reduzieren lässt.
Geerbtes Haus ohne Wenn und Aber zehn Jahre halten
„In der politischen Diskussion fällt leider völlig unter den Tisch, dass geerbte Familienhäuser schon heute steuerfrei bleiben, wenn man bestimmte Regeln beachtet“, erläutert Prof. Dr. Sven Gelbke, Gründer des Erbrechtsportals „Die Erbschützer“. Mit Steuernachzahlungen müssen Erben beim Familienheim erst dann rechnen, wenn sie dieses in den ersten zehn Jahren nach der Erbschaft veräußern statt selber drin zu leben. Verschenkt die überlebende Ehefrau etwa das geerbte Familienheim vor Ablauf von zehn Jahren an die Kinder und lässt sich gleichzeitig ein lebenslanges Wohnrecht einräumen, fällt Erbschaftsteuer an. Steuerfrei ist nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b + 4c Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) unter den dort näher bezeichneten Voraussetzungen der Erwerb des Eigentums oder Miteigentums an einem sogenannten Familienheim von Todes wegen durch den überlebenden Ehegatten, Lebenspartner, Kinder und Enkel. Familienheim ist ein bebautes Grundstück mit maximal 200 qm Wohnfäche, auf dem der Erblasser bis zum Erbfall eine Wohnung oder ein Haus zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat. Beim Erwerber muss die Immobilie unverzüglich „zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken“ bestimmt sein.
Immobilie bloß nicht tauschen
Das steuerfreie Familienheim darf nicht durch ein vergleichbares, ebenfalls zur Erbmasse gehörendes Objekt ersetzt werden, entschied das Niedersächsisches Finanzgericht (Urteil vom 13.3.2024, Az.: 3 K 154/23). In dem Fall wollte ein Steuerpflichtiger, der nach dem Tode seiner Mutter deren alleiniger Erbe war, die Steuerbefreiung für das Familienheim in Anspruch nehmen. Er tat dies allerdings nicht für die von der Mutter bis zu ihrem Tode genutzte Wohnung, sondern für seine eigene, von der Erblasserin gemietete Wohnung im selben Objekt. Die bis dahin von der Mutter bewohnte Einheit vermietete er. Das hielt er für die sinnvollere Lösung, anstatt die beiden etwa baugleichen Wohnungen auszutauschen. Ein Austausch komme nicht in Frage, entschied das Niedersächsische Finanzgericht. Voraussetzung für eine Steuerbefreiung ist, dass exakt das vom Erblasser bewohnte Objekt weitergenutzt wird.
Zeitnah in die geerbte Immobilie einziehen
Wer eine Immobilie erbt, muss Erbschaftsteuer zahlen, wenn er nicht selbst zeitnah einzieht. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass die geerbte Wohnung oder das geerbte Haus unverzüglich zur Selbstnutzung bestimmt und zehn Jahre selbst bewohnt wird. In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Fall (Aktenzeichen: II R 6/21) hatte sich der Einzug einer Alleinerbin eines Zweifamilienhauses infolge des Handwerkermangels um ein ganzes Jahr verzögert. Das zuständige Finanzamt hatte die Erbschaftsteuerbefreiung daraufhin widerrufen und die Steuer festgesetzt. Der BFH kippte diesen Bescheid. Zwar müssten Erben eines Familienheims Renovierungsarbeiten so schnell durchführen, wie es ihren persönlichen Möglichkeiten entspricht. Es sei ihnen aber nicht anzulasten, wenn sie die Renovierungsarbeiten unverzüglich in Auftrag geben, die beauftragten Handwerker sie aber aus Gründen, für die die Erben nichts können, nicht rechtzeitig ausführen. Dazu zählt etwa eine hohe Auftragslage. „Ist der Handwerker allerdings als unzuverlässig bekannt, empfiehlt es sich, Alternativangebote einzuholen. So kann man dem Finanzamt gegenüber nachweisen, dass man sich um eine zeitnahe Sanierung bemüht hat“, empfiehlt Prof. Dr. Sven Gelbke vom Erbrechtsportal „Die Erbschützer“.
Erbschaftsteuerbefreiung trotz vorzeitigem Auszug
Ein Erbe verliert nicht die Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim, wenn ihm die eigene Nutzung des Familienheims aus gesundheitlichen Gründen unmöglich oder unzumutbar ist. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 01.12.2021 – II R 18/20 entschieden. Die spätere Klägerin hatte das von ihrem Vater geerbte Einfamilienhaus zunächst selbst bewohnt, war aber bereits nach sieben Jahren ausgezogen. Im Anschluss wurde das Haus abgerissen. Die Frau argumentierte, sie habe sich angesichts ihres Gesundheitszustands (Bandscheibenvorfälle, ein Hüftleiden, das wegen einer Angststörung nicht operabel war) kaum mehr allein in dem Haus bewegen können und sei daher in eine Erdgeschosswohnung umgezogen. Grundsätzlich, so der BFH, setzt die Steuerbefreiung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 4c des Erbschaftsteuergesetzes voraus, dass der Erbe für zehn Jahre das geerbte Familienheim selbst nutzt, es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen daran gehindert. Prof. Dr. Sven Gelbke kommentiert die Entscheidung: „Reine Zweckmäßigkeitserwägungen, wie etwa die Unwirtschaftlichkeit einer Sanierung, genügen nicht, um steuerfrei vor zehn Jahren aus dem Haus auszuziehen. Anders sieht es aber aus, wenn der Erbe aus gesundheitlichen Gründen für eine Fortnutzung des Familienheims so erheblicher Unterstützung bedarf, dass nicht mehr von einer selbständigen Haushaltsführung gesprochen werden kann.“
Schwere Depressionen können vorzeitigen steuerfreien Auszug aus dem Familienheim rechtfertigen
Zieht der überlebende Ehepartner aus dem geerbten Familienheim aus, weil ihm dessen weitere Nutzung aus gesundheitlichen Gründen unmöglich oder unzumutbar ist, entfällt die ihm beim Erwerb des Hauses gewährte Erbschaftsteuerbefreiung nicht rückwirkend. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 01.12.2021 (Az.: II R 1/21) zu § 13 Abs. 1 Nr. 4b des Erbschaftsteuergesetzes (ErbStG) entschieden. Die spätere Klägerin hatte mit ihrem Ehemann ein Einfamilienhaus bewohnt und wurde nach dessen Tod aufgrund Testaments Alleineigentümerin. Nach knapp zwei Jahren veräußerte sie das Haus und zog in eine Eigentumswohnung. Prof. Dr. Sven Gelbke erklärt, warum: „Die Frau litt an Depressionen, die sich nach dem Tod ihres Ehemannes gerade durch die Umgebung des ehemals gemeinsam bewohnten Hauses verschlechtert hatten. Ihr Arzt riet ihr daraufhin, das Haus zu verlassen.“ Dennoch war das Finanzgericht der Ansicht, es habe keine zwingenden Gründe für den Auszug gegeben, da der Klägerin nicht die Führung eines Haushalts schlechthin unmöglich gewesen sei. Der BFH hat das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen. Die Bundesfinanzrichter stellten klar, dass eine Unzumutbarkeit der Selbstnutzung des Familienheims auch in einer erheblichen Gesundheitsbeeinträchtigung infolge des Verbleibs im Familienheim liegen kann.
Unverzüglicher Einzug in die geerbte Immobilie auch nach über einem halben Jahr möglich
Prof. Dr. Sven Gelbke macht auf ein häufig anzutreffendes Problem bei Erbschaften aufmerksam: „Nicht immer ist mit dem Erbfall sofort klar, wer die Immobilie erbt. In Erbengemeinschaften muss das Eigentum oft über Jahre unter den Erben aufgeteilt werden. Die Finanzämter gehen aber bisweilen davon aus, dass die Erbauseinandersetzung innerhalb von einem halben Jahr erfolgen muss. Doch diese Regel ist nirgends festgeschrieben“. In seinem Urteil vom 15. Mai 2024 (Az.: II R 12/21) hat der Bundesfinanzhof (BFH) entscheiden, wie lange die Erben für die Auseinandersetzung in einer Erbengemeinschaft Zeit haben, um noch erbschaftsteuerliche Begünstigungen in Anspruch nehmen zu können. Der Fall: Die Eltern des Steuerpflichtigen starben kurz nacheinander. Der Steuerpflichtige und sein Bruder beerbten sowohl die Mutter als auch den Vater je zur Hälfte. Zum Nachlass der Mutter gehörten unter anderem Grundstücke, zum Nachlass des Vaters gehörten ebenfalls Grundstücke, sowie Beteiligungen an mehreren Gesellschaften. Die Erbauseinandersetzung erfolgte erst drei Jahre nach dem Erbfall. Das Finanzamt erhob daraufhin ohne Privilegierung Erbschaftsteuern, weil angeblich die 6-Monats-Frist nach dem Erbfall abgelaufen sei. Zu Unrecht: Eine sechsmonatige Frist ist im Gesetz nirgendwo erwähnt, betonte der Bundesfinanzhof und gab den Erben Recht.
Wohnrecht reicht nicht für die Steuerbefreiung
Ein von der Erbschaftsteuer befreiter Erwerb eines Familienheims liegt nur vor, wenn der länger lebende Ehegatte Eigentum oder Miteigentum an einer als Familienheim begünstigten Immobilie des verstorbenen Ehegatten erwirbt und diese zu eigenen Wohnzwecken selbst nutzt. „Das in einem Testament eingeräumte Wohnrecht an dem Familienheim führt dagegen nicht zu einer Steuerbefreiung“, erklärt Prof. Dr. Sven Gelbke unter Hinweis auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs (Az: II R 45/12). In dem zugrundeliegenden Streitfall war die Klägerin zwar Miterbin ihres verstorbenen Ehemannes. Entsprechend den testamentarischen Verfügungen wurde jedoch das Eigentum an dem zum Nachlass gehörenden Grundstück an die beiden Kinder des Erblassers übertragen und der Klägerin im Gegenzug ein lebenslanges Wohnrecht an der vormals gemeinsamen ehelichen Wohnung eingeräumt. Das Finanzamt setzte Erbschaftsteuer fest, ohne die Steuerbefreiung für Familienheime zu berücksichtigen. Der BFH bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Ist der Erwerber – wie im Streitfall – aufgrund eines testamentarisch angeordneten Vorausvermächtnisses verpflichtet, das Eigentum an der Familienwohnung auf die Kinder des Erblassers zu übertragen, kann er die Steuerbefreiung trotz Wohnrechts nicht in Anspruch nehmen.
Weitere Informationen unter: JustSolutions GmbH, Geschäftsführer: Lukas Lewandowski, Bonner Straße 484-486, 50968 Köln (Marienburg), E-Mail: [email protected]