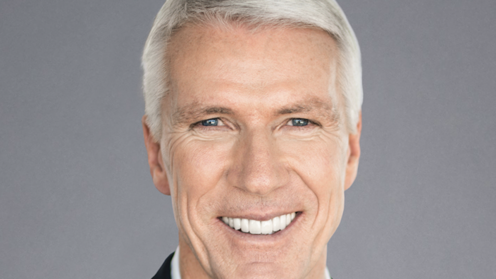300 Millionen Euro hinterzogene Steuern – allein in Nordrhein-Westfalen. Das ist die Zahl, die gerade durch die Schlagzeilen rauscht. Verantwortlich sein sollen keine multinationalen Konzerne oder alteingesessenen Wirtschaftsbosse, sondern Influencerinnen und Influencer – die vermeintlich gierigen Gesichter einer „oberflächlichen“ Generation.
Die mediale Inszenierung ist perfekt: eine polarisierende Zielgruppe, eine klare Täterrolle, spektakuläre Ermittlungen. Doch während hier mit aller Härte durchgegriffen wird, stellt sich die Frage: Gilt diese Konsequenz auch für diejenigen, die an den Hebeln der Macht sitzen?
Seit Januar 2025 ermittelt in NRW das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität mit einem speziell eingerichteten „Influencer-Team“. Rund 6.000 Social-Media-Profile werden ausgewertet, das mutmaßliche Steuerstrafvolumen: 300 Millionen Euro.
Bereits 200 Strafverfahren sind eröffnet, die Verdächtigen oft mit hohen fünfstelligen bis millionenschweren Einnahmen. Manche leben offiziell im Ausland, posten jedoch weiterhin aus Deutschland – ein klassischer Versuch, steuerpflichtige Einkünfte zu verschleiern.
Dass Steuerhinterziehung verfolgt werden muss, steht außer Frage. Sie schadet dem Gemeinwesen, untergräbt das Vertrauen in das Steuersystem und bevorzugt diejenigen, die sich ihrer Pflicht entziehen. Doch die Vehemenz, mit der die Ermittlungen hier vorangetrieben werden, verdient einen genaueren Blick.
Die Rolle der medialen Erzählung
Influencer sind für die Öffentlichkeit ein gefundenes Fressen:
- jung, reich, öffentlich sichtbar
- leicht mit Schlagworten wie „gierig“ oder „abgehoben“ zu framen
- für viele ohnehin Symbol einer Welt, die sie nicht verstehen oder nicht ernst nehmen
Ein Sondereinsatzkommando beim Finanzamt, Schlagzeilen mit Millionenbeträgen und ein paar glamouröse, aber „entlarvte“ Gesichter – schon ist die Story perfekt.
Diese Form der Berichterstattung schafft klare Fronten und erzeugt den Eindruck, dass der Staat entschlossen handelt. Doch sie wirft auch die Frage auf: Warum erleben wir dieselbe Entschlossenheit so selten, wenn es um politische Verantwortung geht?
Beispiele gibt es zuhauf:
- Robert Habeck und das umstrittene Steuergeld-Desaster im Zuge eines einzelnen Amtsdeals – rund 600 Millionen Euro Kosten für den Steuerzahler.
- Jens Spahn und die Milliardenverluste bei der Maskenbeschaffung in der Corona-Pandemie.
- Ursula von der Leyen und die verschwundenen Chatprotokolle im Zusammenhang mit milliardenschweren Impfstoffverträgen.
- Olaf Scholz, der sich in zentralen Untersuchungsausschüssen plötzlich nicht mehr an entscheidende Absprachen erinnern kann.
Hier geht es nicht um vergessene Quittungen oder unklare Rechnungsstellung – es geht um Summen, die den NRW-Influencerfall um ein Vielfaches übersteigen. Trotzdem gibt es in vielen Fällen weder strafrechtliche Ermittlungen noch nennenswerte politische Konsequenzen. Im Gegenteil: Mancher verlässt das Amt mit Ehren, wird auf EU-Ebene befördert oder übernimmt neue Spitzenposten in der eigenen Partei.
Verhältnismäßigkeit als Frage der Moral
Es geht nicht darum, Politiker „wie Influencer zu jagen“.
Es geht darum, gleiche Maßstäbe bei der Verantwortung anzulegen – und zwar unabhängig davon, ob es sich um einen Social-Media-Star mit 500.000 Followern oder einen Minister mit Milliardenbudget handelt. Wer die Hoheit über öffentliche Gelder hat, trägt eine besondere Pflicht – und sollte sich nicht hinter Erinnerungslücken, fehlenden Akten oder internen Verfahrensregeln verstecken können.
Denn solange bei einem fünfstelligen Steuerschaden eines Influencers ein medialer und juristischer Rundumschlag erfolgt, während politische Milliardenverluste mit einer Enquete-Kommission „aufgearbeitet“ werden, bleibt beim Bürger das Gefühl: Hier wird mit zweierlei Maß gemessen.
Das größere Problem: Vertrauen
Ein funktionierendes Gemeinwesen lebt davon, dass Bürger den Institutionen vertrauen – und umgekehrt.
Wird dieses Vertrauen durch selektive Konsequenzvergabe untergraben, entsteht eine gefährliche Schieflage. Die Menschen akzeptieren Steuerlast und Regeln nur dann, wenn sie das Gefühl haben, dass alle – wirklich alle – gleich behandelt werden.
Ohne diesen Grundsatz wird jede künftige „Härte des Gesetzes“ gegen Steuerhinterziehung automatisch von einem Beigeschmack begleitet.
Fazit: Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Aber sie darf auch nicht als politisches Ablenkungsmanöver dienen. Wenn wir in einer Demokratie ernsthaft Gerechtigkeit einfordern, dann müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass es „zwei Klassen“ der Verantwortlichkeit gibt – die für Bürger und die für Politiker.
Macht und Moral gehören zusammen – oder sie bedeuten am Ende gar nichts.
Celine Nadolny ist seit 2022 Kolumnistin des Cash.-Magazins sowie von Cash.Online. 2019 gründete sie Book of Finance und wurde zu Deutschlands einflussreichster Sachbuchkritikerin. Mit mehr als 400 rezensierten Sachbüchern erhielt sie mittlerweile zwölf Branchenpreise, ist somit die mistausgezeichnete Finanzbloggerin der DACH-Region und wurde von Forbes auf die 30-Under-30 Liste aufgenommen. Celine möchte so viele Menschen wie möglich dazu inspirieren, mehr zu lesen, ihre Finanzen in die Hand zu nehmen und ein erfülltes Leben zu führen.