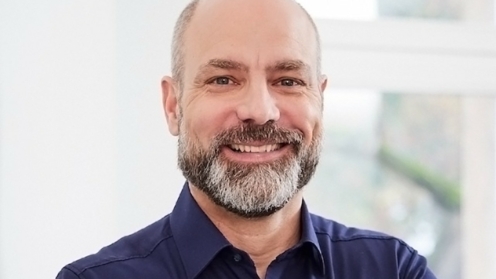Herr Dr. Kraftschik, wie bewerten Sie den Stellenwert des geplanten Betriebsrentenstärkungsgesetzes BRSG II?
Kraftschik: Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass es sich beim BRSG II um einen Schritt in die richtige Richtung handelt, jedoch noch nicht den gewünschten Durchbruch zur Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung herbeiführen wird.
Warum? Wo sehen Sie kritische Punkte?
Kraftschik: Die Möglichkeit, künftig auf betrieblicher Ebene auch ohne tarifvertragliche Grundlage Modelle der automatischen Entgeltumwandlung mit Opting-Out anzuwenden, ist wesentlich zu eng gezogen, weil entsprechende Betriebsvereinbarungen nur in tariflosen Bereichen ermöglicht werden sollen. Auch das Thema Portabilität bleibt ein Dauerbrenner in der betrieblichen Altersversorgung. Geplant ist, diese zwischen einzelnen Sozialpartnermodellen durchgängig zu gestalten. Es handelt sich dabei aber leider um eine „Einbahnstraße“, da eine Mitnahme in eine „klassische“ bAV nicht ermöglicht wird.
Gibt es auch positive Ansätze im neuen Gesetzesvorhaben?
Kraftschik: Positiv hervorheben lässt sich, dass für Geringverdienende der steuerlich begünstigte Arbeitgeberzuschuss auf bis zu 1.200 Euro jährlich angehoben und die Einkommensgrenze dynamisch an die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung gekoppelt werden soll. Allerdings erst mit einer Verzögerung zum 1. Januar 2027. Dann wird die Geringverdienerförderung drei positive Effekte haben.
Erstens wird sie für soziale Gerechtigkeit sorgen, denn Geringverdiener profitieren überproportional von der Erhöhung des Zuschusses, da sie selbst oft nur begrenzte Mittel zur Vorsorge haben. Weiterhin für steuerliche Vorteile, da der Zuschuss steuerlich begünstigt ist, was sowohl für Unternehmen als auch Arbeitnehmende attraktiv ist. Und schließlich wird die Attraktivität des Unternehmens gesteigert. Unternehmen, die Geringverdienende gezielt unterstützen, positionieren sich als sozial verantwortungsbewusst und verbessern ihr Employer Branding.
Und gibt es neben der Geringverdienerförderung noch weitere Vorteile?
Kraftschik: Ebenfalls positiv ist, dass künftig die Möglichkeit geschaffen werden soll, vorzeitig in Rente zu gehen, sofern Teilrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen werden. Dies erhöht die Flexibilität der bAV. Beschäftigte können ihre Arbeitszeit schrittweise reduzieren und gleichzeitig eine Teilrente beziehen – das erleichtert den Übergang in den Ruhestand. Auch erlaubt es die neue Regelung, besser auf persönliche Lebenssituationen einzugehen, etwa bei gesundheitlichen Einschränkungen oder familiären Verpflichtungen. Ältere Beschäftigte können länger in Teilzeit tätig bleiben, was Know-how im Unternehmen hält und gleichzeitig jüngeren Platz schafft. Somit profitiert auch der Arbeitsmarkt davon.
Was kann die Reform leisten, und wo sind ihre Grenzen?
Kraftschik: Die Reform bleibt komplex und ist in hohem Maße vom Engagement der Unternehmen abhängig. Eine Verbreitung der bAV, gerade im KMU-Bereich, sehen wir hier nicht gegeben.
Laut Experten darf auch bei der bAV für eine gute Rendite die volle Beitragsgarantie nicht beibehalten werden Wie sehen Sie das?
Kraftschik: In dieser Frage schließen wir uns der Meinung der Experten an. Angesichts der derzeitigen Kapitalmarktsituation und der geopolitischen Lage ist es sehr schwierig, Kundinnen und Kunden eine attraktive Rendite bei hohen Garantieversprechen zu bieten. Zwar ist es bei einer beitragsorientierte Leistungszusage zulässig, Garantien von unter 100 Prozent anzubieten, sofern die entsprechende Leistung klar definiert und transparent abgeleitet werden kann, allerdings sollte dabei immer das Haftungsrisiko (Einstandspflicht) der Unternehmen im Auge behalten werden. Hier ist der Gesetzgeber in der Pflicht, Änderungen herbeizuführen.
Eine weitere Forderung ist die flexiblere Gestaltung der Rentenbezugsphase. Was meinen Sie dazu?
Kraftschik: Die Gestaltungsmöglichkeiten in der Rentenbezugsphase sind für die Arbeitnehmenden in der bAV deutlich eingeschränkt. Auch hier sehen wir den Gesetzgeber in der Pflicht, die bestehenden Einschränkungen zu lockern und dies auch steuerlich zu begleiten. Nur dann kann die Attraktivität der betrieblichen Altersversorgung für alle Beteiligten erhöht werden.
Trotz des Fachkräftemangels und der demografischen Aussichten ist gerade bei KMU die bAV-Durchdringung gering. Sehen Sie als Produktgeber Möglichkeiten, diese attraktiver zu gestalten?
Kraftschik: Leider wird die bAV – auch als Mittel zur Fachkräftebindung – in KMU noch recht selten eingesetzt. Das zeigt auch unsere Studie aus dem Jahr 2024: Nur rund ein Drittel der KMU nutzt die bAV aktiv in ihrer Personalstrategie. Die Reformen des BRSG II sind sinnvoll, aber noch nicht mutig genug. Ohne verpflichtende Teilnahme, flexiblere Garantien und digitale Vereinfachungen wird die bAV für viele KMU und Beschäftigte mit geringem Einkommen eine Randerscheinung bleiben. Produktgeber haben ein großes Potenzial zur Einflussnahme, jedoch ist auch die Anpassung des Gesetzgebers erforderlich.
Was sollte der Gesetzgeber tun?
Kraftschik: Der Gesetzgeber sollte folgende Maßnahmen ergreifen: Es wird empfohlen, Pflichtsysteme oder verpflichtendes Opting-Out für alle Arbeitgeber einzuführen – nicht nur für tarifgebundene. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Arbeitgeberhaftung bei verschiedenen Zusagearten klarzustellen, um rechtliche Unsicherheiten zu beseitigen.
Welches Fazit ziehen Sie zu den Reformbemühungen des BRSG II?
Kraftschik: Die Reformen des BRSG II sind sinnvoll, aber noch nicht ausreichend mutig. Ohne verpflichtende Teilnahme, flexiblere Garantien und digitale Vereinfachung bleibt die bAV für viele KMU und Beschäftigte mit geringem Einkommen eine Randerscheinung. Die Branche ist bereit für die Umsetzung, jetzt sind politischer Wille und klare Rahmenbedingungen erforderlich.
Die Fragen stellte Silvia Fischer, Finanz- und Versicherungsjournalistin und Cash. Autorin