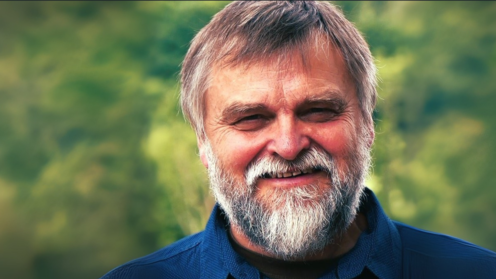Frau Dr. Krämer-Weidenhaupt, Kunst ist für viele vor allem eine Herzensangelegenheit. Ab wann wird aus Leidenschaft ein Vermögensgegenstand mit versicherungsrelevantem Wert?
Krämer-Weidenhaupt: Kunst hat immer einen ideellen Wert. Ein geerbtes Gemälde, eine Zeichnung aus dem Atelierbesuch oder das erste Werk einer jungen Künstlerin: Was emotional wertvoll ist, ist nicht automatisch auch versicherungsrelevant – aber beides kann sich überschneiden. Versicherungstechnisch werden Kunstwerke relevant, sobald sie einen objektiv bezifferbaren Marktwert erreichen. Das kann schon der Fall sein, wenn eine Zeichnung für ein paar hundert Euro gekauft wurde. Entscheidend ist dabei nicht nur der Kaufpreis, sondern auch der Wiederbeschaffungswert. Ich möchte ungern einen festgelegten Wert nennen, denn jeder muss selbst entscheiden wo die eigene Schmerzgrenze liegt, ab der man sich eine spezialisierte Absicherung – über die reguläre Hausratversicherung hinaus – wünscht. Denn im Schadenfall muss nicht nur der finanzielle Verlust gedeckt sein, sondern auch die fachgerechte Restauration – was sehr kostspielig sein kann.
Sie betonten, wie wichtig eine fundierte Dokumentation für den Werterhalt ist. Was sollte aus Ihrer Sicht in keiner Sammlung fehlen, wenn es um eine professionelle Bewertung geht?
Krämer-Weidenhaupt: Eine sorgfältige Dokumentation ist das Rückgrat jeder fundierten Bewertung. Je mehr qualifizierte Informationen zu einem Kunstwerk vorliegen, desto genauer und belastbarer lässt sich der realistische Marktwert ermitteln. Neben den offensichtlichen Werkdetails sind vor allem weiterführende Informationen entscheidend: Provenienz, Ausstellungshistorie, Katalogeinträge, vorhandene Zertifikate, frühere Verkäufe und – nicht zu unterschätzen – die Einordnung in die künstlerische Schaffensphase.
Auch der Zustand eines Werks spielt eine zentrale Rolle, denn Hinweise auf selbst minimale Restaurierungen, Schäden oder konservatorische Eingriffe können den Wert stark beeinflussen. Eine gute Dokumentation erzählt die Geschichte eines Werkes – und macht es damit nachvollziehbar, vergleichbar und bewertbar.
Provenienz gilt heute als zentrales Kriterium für den Wert und die Legitimität von Kunstwerken. Wo liegen aus Sicht der Versicherung die größten Risiken bei unklarer Herkunft?
Krämer-Weidenhaupt: Aus Sicht der Versicherung stellt eine unklare Provenienz ein erhebliches Risiko dar – und dies in mehrfacher Hinsicht. Der versicherte Marktwert kann bei Provenienzproblemen nahezu komplett entfallen. Wenn sich herausstellt, dass die Herkunft lückenhaft oder belastet ist, sinkt nicht nur der Wert drastisch – das Werk kann auch nicht verkauft, öffentlich gezeigt und sogar konfisziert werden. Besonders bei Fällen von Raubkunst, Echtheitszweifeln oder Eigentumsstreitigkeiten wird das zum Problem – sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für den Versicherer. Es besteht außerdem die Gefahr rechtlicher Rückforderungen, hoher Streitkosten und Reputationsschäden. Deshalb ist die Provenienzprüfung heute ein zentrales Instrument im Underwriting-Prozess.
Viele Sammler sind sich nicht bewusst, wie eng das Thema Kunst mit Nachlassplanung und Erbrecht verknüpft ist. Welche steuerlichen Fallstricke und Gestaltungsmöglichkeiten sehen Sie hier?
Krämer-Weidenhaupt: Tatsächlich wird die Kunst im Nachlass oft unterschätzt – emotional wie steuerlich. Anders als bei z.B. Immobilien ist die Bewertung von Kunstwerken oft komplex und interpretationsbedürftig: Wird ein zu hoher Wert angesetzt, steigt die Steuerlast unnötig. Wird der Wert zu niedrig angegeben, drohen Nachprüfungen vom Finanzamt. Zudem ist vielen nicht bewusst, dass es bei der Vererbung oder Schenkung von Kunst keine generellen Steuerbefreiungen gibt – auch nicht, wenn die Werke rein privat genutzt wurden. Eine strategische Nachlassplanung kann helfen, etwa durch vorweggenommene Schenkungen, die Nutzung von Steuerfreibeträgen oder die Einbindung gemeinnütziger Stiftungen und Leihgaben an Institutionen. Gestaltungsspielraum gibt es auch durch die Aufteilung von Sammlungen in werthaltige und ideelle Teile.
Gerade bei zeitgenössischer Kunst schwanken Marktpreise mitunter stark. Wie gelingt es, bei solch volatilen Werten eine belastbare versicherungstechnische Grundlage zu schaffen?
Krämer-Weidenhaupt: Das stimmt – gerade bei zeitgenössischer Kunst können sich Marktpreise innerhalb weniger Jahre deutlich verändern. Diese Volatilität stellt eine besondere Herausforderung für die versicherungstechnische Bewertung dar. Dennoch lässt sich auch hier eine belastbare Grundlage schaffen – durch eine Kombination aus professioneller Wertermittlung, regelmäßiger Aktualisierung und kluger Vertragsgestaltung. Grundsätzlich gilt: Die Versicherungssumme sollte sich am realistischen Marktwert orientieren – nicht am einstigen Kaufpreis.
Bei stark nachgefragten Positionen, deren Preise sich dynamisch entwickeln, ist eine regelmäßige Neubewertung – idealerweise alle zwei bis drei Jahre – unerlässlich. Es können sogenannte Vorsorgeklauseln vereinbart werden, die moderate Marktentwicklungen automatisch abfangen. Fair Value kombiniert Marktfaktoren wie etwa institutionelles Interesse mit einem Blick auf die Eigenschaften des Kunstwerkes wie Ausstellungshistorie in der Wertermittlung. Um so extreme Ausschläge und Trends auszugleichen und einen realistischen Langzeitwert zu bestimmen – jenseits von Zuschlagspreisen als Momentaufnahme oder auf der anderen Seite einem Kunstmarktindex.
Sie sprechen sich für externe Expertisen bei besonders wertvollen Arbeiten aus. Wer sollte Ihrer Meinung nach zwingend eingebunden werden – und wie stellt man deren Unabhängigkeit sicher?
Krämer-Weidenhaupt: Gerade bei hochpreisigen oder historisch bedeutsamen Werken ist eine externe Expertise unerlässlich. Doch genau hier liegt die Schwierigkeit: Unabhängigkeit ist im Kunstmarkt nicht selbstverständlich. Viele Expertinnen und Experten haben wirtschaftliche Interessen – etwa als Vermittler:innen oder Gutachter:innen mit Verkaufsambitionen. Auch Nachlassverwaltungen oder Stiftungen sind nicht immer frei von Zielkonflikten. Deshalb ist es entscheidend, auf geprüfte Fachleute zurückzugreifen – zum Beispiel öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige oder zertifizierte Appraiser, die Mitglied in anerkannten Berufsverbänden von Kunstsachverständigen sind. Diese unterliegen klaren Qualitätsstandards. Auch Auktionshausexperten können eine wertvolle Einordnung geben.
Welche Herausforderungen sehen Sie aktuell in der Versicherbarkeit von digitalen oder hybriden Kunstwerken – etwa bei Installationen mit technischen Komponenten?
Krämer-Weidenhaupt: Bei hybriden oder medienbasierten Installationen, wie sie etwa bei Künstlern wie Jannis Kounellis, Jacolby Satterwhite oder Olafur Eliasson vorkommen, geht es vor allem um die Versicherung von Komplexität und Kontext. Versicherbar ist nicht nur der Materialwert, sondern auch die Wiederherstellbarkeit des Konzepts – inklusive technischer Systeme, Lizenzen oder kuratorischer Anleitungen. Zusätzliche Herausforderung: Der Transport, die Lagerung und die Wiederaufbaukosten solcher Werke sind oft teurer als das Werk selbst. Versicherer müssen daher nicht nur den Wert, sondern auch den Erfahrungsschatz für Aufbau und Instandhaltung in ihre Kalkulation einbeziehen – was ohne dokumentierte Installationsanweisungen kaum möglich ist.
Inwiefern berücksichtigen Versicherungen im Schadenfall auch ideelle Werte oder emotionale Bindungen – oder zählt letztlich nur der Marktwert?
Krämer-Weidenhaupt: Versicherungen arbeiten grundsätzlich mit quantifizierbaren Werten – das heißt: Im Schadenfall zählt in erster Linie der vereinbarte oder feststellbare Marktwert., Persönliche Bedeutungen oder ideelle Werte sind – so schmerzlich das ist – versicherungstechnisch nicht bezifferbar und damit auch nicht erstattungsfähig. Allerdings gibt es Ansätze, um dem zumindest näherzukommen: Etwa durch individuell vereinbarte Versicherungssummen, die sich beispielsweise bei aufstrebenden Positionen ohne etablierten Marktwert daran orientieren, wie hoch die Kosten einer Fachgerechten Restauration wärenOder durch Maßnahmen zur Schadensvermeidung – wie präventive Restaurierung und spezielle Lagerkonzepte. So lässt sich der ideelle Wert zwar nicht versichern – aber der konservatorische Erhalt sichern. Wir können einen Rahmen schaffen, in dem der materielle Ausdruck eines ideellen Wertes respektiert wird.
Kunstversicherung ist ein sensibles und erklärungsbedürftiges Segment – worauf sollten Vermittler im Kundengespräch besonders achten, wenn sie Kunstsammler kompetent beraten wollen?
Krämer-Weidenhaupt: Die Kunstversicherung ist kein Produkt „von der Stange“, sondern lebt von Kontext und Detail. Der Schlüssel liegt also darin, dass Vermittler die richtigen Fragen stellen, bevor sie beraten.
- Wo befindet sich die Kunst? Zuhause, in mehreren Wohnsitzen, im Lager, bei Dritten?
- Wer hat Zugriff? Gibt es Personal, Gäste, Leihverträge mit Museen, Transporte zwischen Risikoorten?
- Wie wird sie genutzt? Wird sie ausgestellt, verliehen oder soll sie im Nachlass weitergegeben werden?
- Wie ist der Zustand dokumentiert? Gibt es Fotos, Gutachten, Provenienznachweise?
Außerdem sollten sie auf realistische Bewertungen achten und sich nicht allein auf historische Kaufpreise verlassen. Auch die Absicherung im Fall von Leihgaben an Museen, Transporte und Installationsrisiken gehören auf den Tisch. Kurzum: Wer Kunst versichern will, muss das Leben der Kunst und ihrer Besitzer:innen verstehen, mit allen Facetten, Eigenheiten und Risiken. Diese Fragen helfen, Risiken realistisch einzuschätzen und die Police individuell zu gestalten – weit über den Hausratstandard hinaus.
Viele Vermittler haben selten Berührungspunkte mit hochwertiger Kunst. Welche Unterstützung brauchen sie aus Ihrer Sicht, um diese anspruchsvolle Zielgruppe fachlich fundiert und rechtssicher bedienen zu können?
Krämer-Weidenhaupt: Die Versicherungsberatung für hochwertige Kunst ist ein anspruchsvolles Feld – und kein Massengeschäft. Deshalb lautet meine ehrliche Antwort: Es kommt darauf an, ob man sich spezialisieren möchte. Wer Kunstsammler:innen seriös begleiten möchte, braucht mehr als nur Produktschulungen: Ein Grundverständnis für das, was Kunst bedeutet – nicht nur monetär, sondern auch in Bezug auf Abläufe und Lebensstile. Vermittlerinnen und Vermittler sollten Kunst und Collectibles einordnen, Marktdynamiken grob einschätzen können und die Abläufe rund um Leihgaben, Transporte, Ausstellungen, Lagerung und Restaurierung verstehen.
Abschließend gefragt: Welche praktischen Empfehlungen würden Sie privaten Sammlerinnen und Sammlern geben, die ihre Werke optimal absichern und zugleich rechtssicher dokumentieren möchten?
Krämer-Weidenhaupt: Kunst sollte nicht nur aus dem Herzen, sondern auch mit System gesammelt werden. Wer seine Werke optimal absichern und rechtssicher dokumentieren möchte, sollte frühzeitig einige Grundpfeiler etablieren. Dabei ist eine strukturierte Werkliste unerlässlich – mit vollständigen Angaben zu Künstler:in, Titel, Technik, Maßen, Entstehungsjahr, Erwerbsdatum, Kaufpreis und Herkunft. Provenienz, Ausstellungshistorie, Zertifikate oder Gutachten sollten zentral archiviert und digital gesichert werden. Und die regelmäßige Bewertung ist wichtig – besonders bei zeitgenössischer Kunst oder wachsendem Marktwert. Der Versicherungswert sollte alle paar Jahre angepasst werden, idealerweise durch eine unabhängige Expertise. Zudem sollten die Werke nicht nur versichert, sondern auch konservatorisch richtig gelagert oder präsentiert werden – denn Schäden durch Licht, Temperatur oder Transport lassen sich vermeiden.