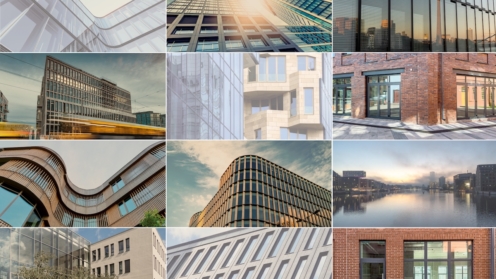Herr Wirth, Sie haben in einem Interview mit Cash. ein verpflichtendes Schulfach „Wirtschaft und Finanzen“ gefordert, von der Grundschule bis zum Abitur. Nicht als loses Modul, sondern als fester Bestandteil des Lehrplans. Was hat Sie zu dieser Forderung gebracht? Was beobachten Sie?
Wirth: Ich habe selbst drei Kinder und kann daher aus der Praxis sprechen. Was an den Schulen zum Thema Finanzbildung vermittelt wird, ist – freundlich gesagt – null bis dürftig. Deswegen halte ich es mit Blick auf den Bildungsauftrag der Schulen für dringend notwendig, darüber nachzudenken, wie sich das ändern kann. Ich habe mal in ein paar Schulgesetze reingeschaut: Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, ihr Leben selbständig, verantwortungsbewusst, friedlich und freiheitlich demokratisch zu gestalten. Besonders die Stichworte „selbständig“ und „verantwortungsbewusst“ sind für mich zentral. Das bedeutet: Wenn die Jugendlichen die Schule verlassen, sollen sie in der Lage sein, mit ihrem Leben klarzukommen. Dazu gehört natürlich auch ein gesundes Maß an Finanzbildung. Aber das bekommen sie – jedenfalls praxisorientiert – in der Schule keinesfalls mit.
Ich muss an der Stelle einmal nachhaken: Sie hatten ja geschrieben „von der Grundschule bis zum Abitur“. Haben Sie das genauso gemeint? Oder denken Sie andere Schulabschlüsse dabei auch mit?
Wirth: Ja, die kann man selbstverständlich mitdenken. Es geht um den Bildungsauftrag des Staates – und der macht nicht bei bestimmten Schulformen Halt, sondern betrifft natürlich alle Schulformen.
Frau Schmerr, ein verpflichtendes Schulfach sehen Sie eher nicht, oder?
Schmerr: Nein. Ich halte ein verpflichtendes Fach „Wirtschaft und Finanzen“ weder für zielführend noch für produktiv. Die Forderung nach einem Pflichtfach „Wirtschaft“ kam erstmals um das Jahr 2000 herum auf – überwiegend von Akteuren der Finanzindustrie oder der privaten Altersvorsorge. Wir haben seither in kaum einem Fachbereich wie den Sozialwissenschaften einen so deutlichen strukturellen Wandel hin zu ökonomischen Inhalten erlebt. Die Schulen haben vielfach Gemeinschaftskunde oder Gesellschaftslehre umgestellt – auf Wirtschaftspolitik oder Arbeit/Technik/Wirtschaft. Die curricularen Anteile für Wirtschafts- und Finanzthemen sind bereits enorm gestiegen. Es ist also schon viel passiert. Leider haben wir in den seltensten Fällen eine gesellschaftliche Debatte über die Frage, welche Inhalte an Schulen wirklich so wichtig sind, dass sie ein eigenes Pflichtfach brauchen. Aus Sicht der GEW ist die entscheidende Frage: Wie gewichtet man die Inhalte an Schulen so, dass sie eine umfassende Bildung ermöglichen?
Wirth: Finanzwissen ist lebensnotwendig. Die jungen Menschen müssen wissen, was auf sie zukommt, wenn sie ihren ersten Mietvertrag unterschreiben oder wenn sie Absicherung für Lebensrisiken betreiben wollen. Das ist doch mindestens so wichtig wie eine Gedichtanalyse. Ich maße mir gar nicht an, zu sagen, welches Fach dafür gestrichen werden soll. Das ist Sache derjenigen, die die Pläne machen. Aber ohne ein Pflichtfach bleibt es Stückwerk.
Schmerr: Ich würde Ihnen insoweit zustimmen, dass zum Beispiel Steuern in den Unterricht gehören – ihre Systematik, ihre Funktion, ihre politische Gestaltung. Das gehört auf den Lehrplan, zum Beispiel in Mathematik oder im sozialwissenschaftlichen Bereich. Das Ausfüllen einer Steuerbescheinigung aber nicht. Das kann man vielleicht mal in einer Nachmittags-AG machen. Dasselbe gilt für die Mieten: Es ist total interessant für junge Leute, warum die Mieten so explodieren, dass man sich in bestimmten Städten oder Vierteln überhaupt keine Wohnung mehr leisten kann. Das zu analysieren und zu schauen, wo man Beratung findet, gehört in den Unterricht. Aber nicht unbedingt das Ausfüllen eines Mietvertrags. Doch das höre ich bei denjenigen, die für ein Pflichtfach sind, teilweise heraus: dass es um ganz lebenspraktische Dinge geht. Die Schule ist zwar für das Leben zuständig, aber nicht für die Lösung lebenspraktischer Probleme auf jedem Gebiet.
Der Kabarettist Christian Ehring hat in einer TV-Sendung einige Schulfächer aufgezählt, deren Einführung in den letzten Jahren von verschiedenen Interessenverbänden gefordert wurde. Dabei waren unter anderem Klima, Ernährung, Datenschutz, Wirtschaft, Feuerwehr, Digitalisierung, Zukunft, Gesundheit, Glück, Denkmalpflege, Drogenkunde, Yoga, Mode, Wiederbelebung und Emotionen. Frau Schmerr, für die Schulen würde sich dann doch die Frage stellen: Was soll dafür wegfallen?
Schmerr: Ja, das ist so. Der Lehrplan hat nur begrenzt Spielraum für immer neue, partikulare Inhalte. Deshalb muss man – als Bildungspolitiker, aber auch als Akteur, der eine Forderung stellt – sagen, wo gestrichen werden soll. Rechnen, Lesen, Naturwissenschaften, Fremdsprachen – diese Kernfächer sind auch deshalb nie gestrichen worden, weil sie sehr sinnvoll sind. Aber auch die GEW sagt: Der Lehrplan muss entrümpelt werden. Nur dann kommen wir weg von diesen Fächerkonkurrenzen und den überlasteten Stundenplänen – und den jahrmarktähnlichen Zuständen, wenn man sieht, wie viele Lobbyisten wie viele neue Fächer fordern.

Martina Schmerr, GEW (Foto: GEW)
Können Sie dieses Dilemma nachvollziehen, Herr Wirth?
Wirth: Klar kann ich das nachvollziehen. Aber ich möchte es nochmal auf den Punkt bringen: Finanzbildung ist Allgemeinbildung – und deswegen finde ich sie als verpflichtendes Schulfach wichtiger als zum Beispiel Yoga. Die Schule soll die Schülerinnen und Schüler doch befähigen, auch Praxiskompetenz im Leben zu haben. Es kann nicht nur um Theorie gehen. Und zu Praxiskompetenz gehört eben auch das Wissen, dass es beim Mietvertrag zwei verschiedene Vertragspartner gibt und dass man nicht blind alles unterschreiben sollte. Und dazu gehört auch, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man ein Konto eröffnet. Wenn die Finanzbildung nicht in der Schule stattfindet, übernehmen TikTok & Co. und das kann niemand ernsthaft wollen. Wir erleben einen massiven Umbruch im Denken der Kinder und Jugendlichen und in unserer ganzen Gesellschaft. Wenn wir nicht zügig darauf reagieren – auch mit den Lehrplänen – dann haben wir ein Riesenproblem.
Wird die Gefahr der sogenannten Finfluencer von den Schulen unterschätzt, Frau Schmerr?
Schmerr: Unterschätzt nicht, aber es ist spürbar, dass der Bildungsbereich überfordert ist mit dem, was aus den sozialen Medien in die Welt der Schülerinnen und Schüler eindringt; und er ist ja auch nur begrenzt handlungsfähig. Es gibt ja gerade viele Debatten über Smartphone- und Social-Media-Verbote an den Schulen. Aber was nützt es, wenn man vormittags in der Schule kein Smartphone nutzen darf, aber nachmittags zu Hause umso mehr?
Der AfW fordert Kooperationen mit der Praxis, damit Finanzexperten ihr Wissen an die Schulen bringen können. Finanzberater als Ersatzlehrer – was halten Sie davon, Frau Schmerr?
Schmerr: Aus GEW-Sicht wäre es bei lebenspraktischen Dingen sehr viel ratsamer, die Verbraucherbildung zu stärken, indem etwa die Verbraucherzentralen regelmäßig an den Schulen Station machen und über Mietverträge oder Anlageformen informieren – und zwar verbraucherkritisch und ausgewogen. Das würde verhindern, dass bestimmte Inhalte zu einseitig von Externen im Unterricht vermittelt werden.
Wirth: Aber die Verbraucherzentralen haben gar nicht genug qualifiziertes Personal, um so etwas an den Schulen zu übernehmen. In unserer Branche dagegen gibt es viele qualifizierte Praktiker, die dazu bereit wären. Und ich rede nicht davon, dass die vermeintliche Lobby an die Schulen will, sondern einzelne engagierte Menschen. Ich kenne viele davon. Ich selbst war an Praxistagen an Schulen und habe mit Schülerinnen und Schülern über Finanzthemen gesprochen – übrigens mit einem super Feedback. In anderen Berufszweigen funktioniert das ja auch: Wenn Ärzte an den Schulen über Sexualkunde sprechen dürfen, warum sollten Finanzexperten nicht auch Finanzbildung vermitteln? Die Angst, die da immer mitschwingt, dieses „Naja, am Ende wird ja doch ein Produkt verkauft“, ist meiner Meinung nach zum größten Teil unberechtigt. Ein letztes Restrisiko könnte man über eine systematische und strukturierte Vorbereitung oder auch Normung dessen, was im Unterricht vermittelt werden soll, minimieren. Im „Normungsausschuss Finanzen“, dem ich angehöre, wird beim DIN-Institut gerade daran gearbeitet, eine Norm für Finanzbildung zu entwickeln. Ich lade Sie, Frau Schmerr, gerne ein, dabei mitzumachen.

Es gibt aus der Finanzbranche alternative Lösungsvorschläge zum Thema Finanzbildung. Für Guido Bader, Vorstandschef der Stuttgarter Versicherung, wäre es klüger, die bestehenden Fächer sinnvoll zu ergänzen, statt immer neue Inhalte in einen eh schon übervollen Stundenplan zu quetschen. Deshalb wäre sein erster Impuls nicht „mehr Finanzbildung“, sondern „mehr und besserer Unterricht in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).“
Schmerr: Da würde ich mitgehen. Ich bin sehr dafür – das wird Ihnen nicht gefallen, Herr Wirth – die Finanzbildung als Querschnittsaufgabe zu betrachten und zu schauen, wo sie bereits Thema ist. Das ist der Fall in Mathematik – da sind Steuern und Zinsrechnung Thema – und in den Sozialwissenschaften bis hin zu Deutsch, Erdkunde und Arbeitslehre. Es gibt viele Fächer, in denen Finanzbildungsinhalte enthalten sind. Wir müssen weg von einer „Lebensbewältigungs“-Inhaltsforderung hin zu einem allgemeinbildenden Anspruch von wirtschaftlicher Bildung.
Wirth: Natürlich müssen die MINT-Fächer verstärkt werden – das ist gar nicht die Frage. Aber trotzdem brauchen wir auch praktische Inhalte, damit die jungen Menschen ihr Leben selbstbestimmt gestalten können, wenn sie die Schule verlassen. Ob das ein wöchentliches Unterrichtsfach ist oder Projekttage, sei erstmal dahingestellt. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass Praktiker mit den jungen Menschen reden und ihnen ein gewisses Rüstzeug an die Hand geben.
Schmerr: Darf ich noch eine kritische Bemerkung machen? Wir sind von der Grundlage ausgegangen, dass die Menschen in Deutschland zu wenig Ahnung von Finanzen haben. Bei der letzten Erhebung der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) zur finanziellen Kompetenz kam allerdings heraus, dass Deutschland im europäischen Vergleich eigentlich ganz gut dasteht – im oberen Mittelfeld. Das ist ja schon mal was, ganz ohne Finanzbildungsstrategie. Im Lesen sind die Deutschen übrigens auch nicht viel besser. Ich habe den Eindruck, dass das Finanzbildungsniveau in Deutschland gar nicht so schlecht ist, wie immer behauptet wird.
Wirth: Da bin ich leider nicht so optimistisch wie Sie. Ich denke, dass wir dringenden Handlungsbedarf haben. Ansonsten wird es immer schlimmer: steigende Überschuldung, Altersarmut – und TikToker als diejenigen, die die Finanz- und Altersvorsorgeberatung machen. Und letztere ist nun mal dringend nötig. Täglich lesen wir Schlagzeilen, wie schlecht es mit der gesetzlichen Rente aussieht und wie dringend notwendig private oder betriebliche Altersvorsorge sind. Wenn man davon in der Schule nie etwas gehört hat, laufen wir als Gesellschaft gegen die Wand.
Schmerr: Dann sollten wir uns aber mehr überlegen als die Idee, dass die Schule ausgleichen oder besser machen soll, was auf TikTok schiefläuft. Das ist eine Entwicklung, bei der Schule ständig neuen Ansprüchen ausgesetzt wird. Sie haben ja Recht: Die Schule ist der Ort, an dem alle Kinder sind. Sie muss die Grundlage für Bildung und den Schutz von Kindern und Jugendlichen legen. Aber die Schule kann nicht alles lösen.
Machen wir es uns als Gesellschaft zu einfach, wenn wir die Verantwortung für Themen wie Finanzbildung immer in Richtung der Schulen abschieben?
Schmerr: In der Tat wird oft unterschätzt, dass die wichtigste Sozialisierungsinstanz die Eltern sind. Sobald die Pubertät beginnt, wird die Peergroup – also gleichaltrige Kinder oder Jugendliche – zur zweitwichtigsten. Wenn man da keinen Fuß in die Tür kriegt, hat man als Schule nur begrenzt Möglichkeiten. Aber die Aufgaben werden ständig aufgestockt und die Hoffnung „Schule kann alles reparieren“ wird ständig geschürt – und damit vielleicht auch ein Bewusstsein unter Eltern: „Muss ich mich nicht drum kümmern, soll mal die Schule machen.“ Aber das schafft Schule nicht allein. Das schafft sie nur gemeinsam mit den Eltern, dem Stadtteil, der Kommune, der ganzen Gesellschaft.
Wirth: Aber wir haben nun mal Themen, die in vielen Elternhäusern nicht gelöst werden können – gerade auch mit Blick auf das Migrationsthema. Und da wir über gesamtgesellschaftliche Probleme reden, ist es Aufgabe des Staates – und damit auch der Schulen – an diese Probleme heranzugehen und zu versuchen, sie zu lösen. Daran kommen wir als Gesellschaft nicht vorbei.
Die Diskussion leitete Kim Brodtmann, Cash.