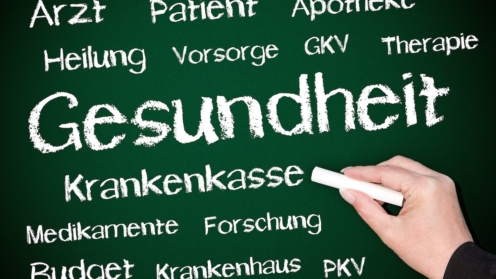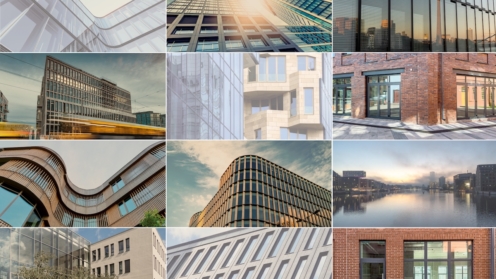Vor dem Start der neuen Expertenkommission zur Modernisierung der Schuldenregel des Grundgesetzes hat der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen klare Worte gefunden. Angesichts wachsender Verschuldung sei eine wirksame Begrenzung der Neuverschuldung wichtiger denn je, heißt es in seinem Gutachten.
Bund und Länder hatten die Schuldenbremse zwischen 2020 und 2023 aufgrund von Pandemie und Energiekrise mehrfach ausgesetzt. Im Frühjahr kam ein schuldenfinanziertes Sondervermögen für Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben im Umfang von 500 Milliarden Euro hinzu. Der Beirat warnt, dass diese Entwicklung die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und die Stabilität des Euro gefährden könnte.
Während SPD, Grüne und Linke eine Lockerung oder gar Abschaffung der Schuldenbremse fordern, verweist die private Krankenversicherung auf den ursprünglichen Sinn der Regelung. „Die Schuldengrenze ist gelebte Nachhaltigkeit und ein Bollwerk für Generationengerechtigkeit“, betont PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther. Besonders deutlich wird die Schutzfunktion der Schuldenbremse im Vergleich mit den umlagefinanzierten Sozialversicherungen. Dort entstehen sogenannte implizite Schulden, weil heutige Leistungsversprechen ohne Vorsorge in die Zukunft verschoben werden.
Florian Reuther: „Schuldengrenze ist gelebte Nachhaltigkeit“
Wie groß diese Lasten sind, zeigt die neue Generationenbilanz der Stiftung Marktwirtschaft. Unter Leitung von Bernd Raffelhüschen vom Forschungszentrum Generationenverträge an der Universität Freiburg wird anhand von Demografie, Beitrags- und Leistungserwartungen die Nachhaltigkeit der Sozialsysteme berechnet. Das Ergebnis: Schon 2025 erreicht die implizite Verschuldung der Gesetzlichen Krankenversicherung rund 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in der Sozialen Pflegeversicherung knapp 50 Prozent. Auf Basis der aktuellen Wirtschaftsleistung summiert sich die Nachhaltigkeitslücke auf etwa 4,7 Billionen Euro.
Treiber dieser Entwicklung ist der demografische Wandel. Mit dem Eintritt der Babyboomer ins Rentenalter sinkt die Zahl der Erwerbstätigen rapide: Bis 2030 um 1,5 Millionen, bis 2035 um 5,8 Millionen Personen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Ruheständler um 4,5 Millionen. Im Umlageverfahren bedeutet das, dass immer weniger Beitragszahler für immer mehr Leistungsempfänger aufkommen müssen. Anders als die private Krankenversicherung, die über Alterungsrückstellungen vorsorgt, haben GKV und Pflegeversicherung dafür keine Rücklagen, betonen die Autoren des Beitrags.
Steigende Beitragssätze in der GKV
Die Folgen würden Versicherte bereits spüren: Zum Jahresbeginn 2025 stiegen die Krankenkassenbeiträge von 16,3 auf durchschnittlich 17,5 Prozent. Der GKV-Spitzenverband warnt schon jetzt vor weiteren Erhöhungen im Jahr 2026. Auch langfristig zeigt die Projektion von Martin Werding, Mitglied im Sachverständigenrat, einen deutlichen Aufwärtstrend: Der Gesamtbeitrag zur Sozialversicherung könnte bis 2035 auf 47,5 Prozent steigen. Damit träfe die Mehrbelastung vor allem die jüngeren Generationen, während ältere Versicherte stärker von den Leistungen profitieren.
„Die fiskalisch und demografisch guten Zeiten, in denen sich die Sozialversicherungen in den vergangenen Jahren bewegt haben, sind unwiderruflich vorbei“, schreiben die Autoren der Generationenbilanz. Sie fordern eine Finanzierungsstrategie, die Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit in den Vordergrund stellt. Künftig dürften Leistungszusagen nicht mehr vor ihrer Finanzierung beschlossen werden. Eine Einbeziehung der impliziten Schulden in eine reformierte Schuldenbremse könne dabei ein wichtiger Schritt sein, so die Autoren.