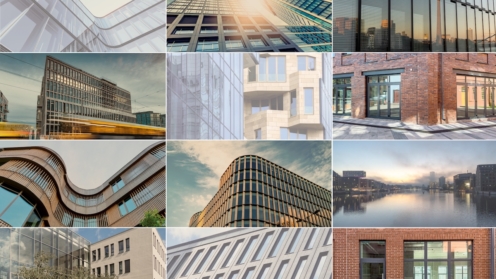Die BarmeniaGothaer betont, dass Nachhaltigkeit fester Bestandteil der Kapitalanlagestrategie ist. Wie stellen Sie sicher, dass ESG-Kriterien nicht nur „Add-on“, sondern integraler Bestandteil aller Anlageentscheidungen sind – und wo ziehen Sie Grenzen zwischen Rendite- und Nachhaltigkeitszielen?
Buchhart: Mit dem Launch unserer neuen Unternehmensstrategie setzt der Vorstand seinen klaren Kurs fort: Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Baustein, sondern ein zentraler Unternehmenswert, der sich durch alle Bereiche zieht – von der Kapitalanlage bis zum täglichen Handeln.
Geng: Das Wichtigste für eine erfolgreiche Integration von Nachhaltigkeit besteht aus unserer Sicht darin, das Wissen und Verantwortung für Nachhaltigkeitsthemen breit in der Organisation quer durch alle Teams zu verankern. Und das ist uns in den vergangenen Jahren sehr gut gelungen.
Buchhart: Alle unsere Portfolio-Manager setzen sich mit den Nachhaltigkeitsthemen auseinander, jedes Team hat mindestens einen Nachhaltigkeitsexperten, der sich besonders tief mit dem Thema auskennt. Darüber hinaus finden regelmäßige ESG-Austauschrunden statt, bei denen aktuelle Trends, regulatorische Entwicklungen und innovative Ansätze diskutiert werden. ESG-Aspekte sind fest in unsere Due Diligence- und Entscheidungsprozesse bei allen Assetklassen eingebunden. Schließlich wirken sich Nachhaltigkeitsfaktoren früher oder später auch auf die finanzielle Performance der Investments aus. Wir verfolgen eine renditeorientierte Strategie, aber wir sehen ESG diesbezüglich nicht als Hemmnis, sondern als Chance, Risiken zu minimieren und nachhaltige Wertschöpfung zu fördern. So setzen wir bei unseren Impact/thematischen Investitionen ausschließlich auf wirtschaftliche Modelle, von denen wir überzeugt sind und die uns langfristige Rendite sichern. Innovative zukunftsweisende Geschäftsmodelle zahlen sich aus, da sie oft mit Kosteneinsparungen einhergehen, sei es durch eine bessere Energieeffizienz oder optimierte Lieferketten oder mit anderen Assetklassen wenig korrelierte Erträge liefern. Bei der Erreichung unserer Dekarbonisierungsziele setzen wir auf „Best-in-Transition“ Unternehmen, die mittel- und langfristig wettbewerbsfähiger und resilienter sind, was wiederum mit einer höheren Profitabilität verbunden ist. Grenzen zwischen Rendite- und Nachhaltigkeitszielen ziehen wir nicht, wir tätigen nur Investments, die beides langfristig verbinden und eine ausgewogene Balance aufweisen, d.h. langfristig den Nachhaltigkeitswert steigern und gleichzeitig eine stabile Rendite sicherstellen.
Wie bewerten Sie konkret das Risiko sogenannter „Stranded Assets“ im Portfolio, insbesondere bei fossilen Energieträgern oder CO₂-intensiven Industrien?
Buchhart: Wann und in welcher Höhe bestimmte Investitionen zu „Stranded Assets“ werden, ist äußert schwierig vorauszusagen und zu messen. Es hängt davon ab, wie sich die Gesellschaft, die Politik und Regulatorik, aber auch verschiedene Technologien entwickeln. Aus diesem Grund betrachten wir verschiedene Szenarien und bewerten, welche Auswirkungen sie auf unser Portfolio hätten. Wir sind uns bewusst, dass unsere Szenariobewertungen noch in einem Entwicklungsprozess sind, und arbeiten kontinuierlich daran, diese weiter zu verbessern.
Geng: Zudem überwachen wir die Höhe unserer Investitionen in Unternehmen in den fossilen und besonders CO2-intensive Sektoren und bewerten den Stand ihrer Transformationspläne. Unternehmen mit fossilen Geschäftsmodellen, die keine klaren Strategien für die Dekarbonisierung bieten oder ihre Übergangsprozesse signifikant verzögern, werden nach und nach aus unserem Portfolio ausscheiden, um das Risiko von „Stranded Assets“ zu vermeiden. Sowohl für Kohleenergieunternehmen als auch für Öl- und Gas-Unternehmen haben wir hierfür klare Ziele gesetzt. Wir monitoren kontinuierlich unseren CO2-Fußabdruck bei Unternehmensinvestitionen und Immobilien und setzen uns mittelfristige Dekarbonisierungsziele. Hierbei streben wir an, den Anteil der Unternehmen mit glaubwürdigen Transformationsplänen stetig zu erhöhen, um das Portfolio resilienter gegenüber regulatorischen und marktbedingten Veränderungen zu machen. Bei Immobilien nutzen wir das CRREM-Model (Carbon Risk Real Estate Monitor), um das Risiko von „Stranded Assets“ zu bewerten. Neben den transitorischen Risiken streben wir es an, die physischen Risiken des Klimawandels für unser Portfolio zu bewerten, da diese ebenfalls erheblichen Einfluss haben können.

Natalia Geng (Foto: BarmeniaGothaer)
Welche Rolle spielen Impact-Investments in Ihrem Portfolio, und wie messen Sie den tatsächlichen gesellschaftlichen oder ökologischen Nutzen solcher Anlagen?
Buchhart: Impact-Investments sind ein zentraler Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Bereits 2021 hat sich die Gothaer das Ziel gesetzt, jährlich 200 Millionen Euro in Impact/thematische Assets zu investieren. Auch nach dem Zusammenschluss werden Investitionen weitergeführt werden. Wir zählen dazu green, sustainable und social Bonds, grüne Anleihen bei Immobilien, Investitionen in erneuerbare Energien, aber auch weitere Investitionen mit klarem Nachhaltigkeitsfokus. In den letzten Jahren haben wir unseren Bestand an solchen Investitionen kontinuierlich ausgebaut, so dass sie aktuell circa zwölf Prozent der gesamten Kapitalanlagen ausmachen. Neben Investitionen in erneuerbare Energien und Green Bonds haben wir ein Kommittent für insgesamt 285 Millionen Euro Investitionen in Naturkapital und Impact Venture Fonds unterzeichnet. Auch künftig werden wir nach Möglichkeit versuchen, durch unsere Investitionen Impact zu generieren.
Geng: Die Messung des ökologischen und gesellschaftlichen Nutzens hängt stark vom jeweiligen Investment ab. Bei Investitionen in erneuerbare Energien erfassen wir die produzierte Strommenge in Kilowattstunden, während bei Naturkapital die Höhe der Treibhausgas-Entnahmen sowie einige Biodiversitäts-Indikatoren ermittelt werden. Es gibt keinen allgemein gültigen „fits for all“-Ansatz. Die präzise Messung ist nicht immer einfach. So ist bei einigen Geschäftsmodellen die Bewertung von vermiedenen CO2-Emissionen („avoided emissions“) am aussagekräftigsten. Methodisch ist diese Bewertung jedoch noch nicht vollständig standardisiert. Das sollte uns jedoch nicht daran hindern, in solche Projekte zu investieren, wenn wir von ihrem Nutzen überzeugt sind.

Anton Buchhart (Foto: BarmeniaGothaer)
In Ihrem Nachhaltigkeitsbericht 2024 verweisen Sie mehrfach auf die Bedeutung regulatorischer Leitplanken (zum Beispiel EU-Taxonomie, SFDR). Wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung dieser Vorgaben – und welche Anpassungen fordern Sie von der Politik?
Geng: Im Vergleich zu klassischen finanziellen Kennzahlen ist die Messung der Nachhaltigkeitsauswirkungen noch relativ neues Terrain. Es wird vermutlich noch einige Jahre dauern, bis wir einen einheitlichen Standard erreicht haben. Diese Herausforderungen spiegeln sich in der aktuellen regulatorischen Landschaft wider. Wir befinden uns noch in einer Findungsphase, in der sich die Rahmenbedingungen weiterentwickeln werden. Die größte Herausforderung sehen wir darin, die Vielzahl an Indikatoren zeitnah und präzise erfassen zu können – insbesondere angesichts der oft sehr lückenhaften Datenlage. Zudem erschweren die verschiedenen Interpretationsspielräume die einheitliche Umsetzung der Vorgaben. Das führt aktuell dazu, dass die öffentlich verfügbaren KPIs der Finanzbranche kaum vergleichbar sind, obwohl die Regulierung dieses Ziel eigentlich im Blick hatte. Von Seiten der Politik wünschen wir uns daher eine Konzentration auf wenige, wesentliche Indikatoren, klare und verbindliche Definitionen sowie eine Minimierung der Interpretationsspielräume. Außerdem sollte die gesetzliche Verzahnung und Abstimmung zwischen verschiedenen Regelwerken verbessert werden, um doppelte Dokumentationspflichten und Mehrfacherfassungen zu vermeiden. Ein weiterer Punkt betrifft die Schwellenwerte für die Unternehmensberichterstattung: Wir plädieren dafür, keine zu großzügigen Lockerungen zuzulassen, wie derzeit in der EU geplant. Diese Daten sind für Investoren essenziell, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Gleichzeitig ist es notwendig, die Anzahl der KPIs, insbesondere für kleinere Unternehmen, deutlich zu reduzieren, um die Berichtspflichten handhabbar zu machen.
Angesichts der Debatten um Greenwashing: Wie gewährleisten Sie, dass Ihre Nachhaltigkeitsberichte und die Kennzahlen zur Kapitalanlage für Investoren und Öffentlichkeit nachvollziehbar, überprüfbar und glaubwürdig sind?
Geng: Wir legen großen Wert auf Transparenz und Ehrlichkeit in unserer Berichterstattung. In all unseren Nachhaltigkeitsberichten streben wir an, möglichst umfassende und detaillierte Informationen bereitzustellen – manchmal sogar über die gesetzlichen Anforderungen hinaus, wenn wir den Eindruck haben, dass sie wichtig und relevant sind. Sämtliche Inhalte zu Nachhaltigkeit sind auf unserer Webseite öffentlich zugänglich, um eine einfache Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Und wir versuchen das Kleingedruckte in den Fußnoten zu vermeiden. Unser Ziel ist es, durch offene Kommunikation Vertrauen zu schaffen und glaubwürdig zu bleiben. Wir orientieren uns bereits heute an den neuen europäischen Vorgaben für Nachhaltigkeitsberichte, obwohl diese in Deutschland noch nicht verbindlich vorgeschrieben sind. Damit möchten wir zeigen, dass uns eine transparente und nachvollziehbare Berichterstattung besonders wichtig ist. Neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Bericht haben wir deshalb einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Darin finden sich die aus unserer Sicht wichtigsten Informationen und Kennzahlen – so aufbereitet, dass sie auch für Menschen ohne Fachkenntnisse verständlich sind. Unter Transparenz verstehen wir nicht nur die Offenlegung von Zahlen, sondern auch, unsere Kundinnen und Kunden verständlich auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit mitzunehmen und sie bei den anstehenden Veränderungen zu begleiten.
Die Fragen stellte Kim Brodtmann, Cash.