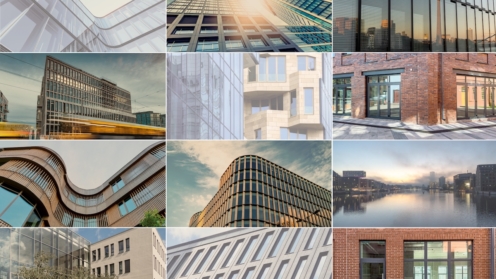Drei wesentliche Kräfte treiben das Geschäftsmodell der eingebetteten Versicherungen voran. Erstens ist der hohe Sättigungsgrad im klassischen Versicherungsgeschäft zu nennen. Signifikantes Wachstum ist bei einigen Versicherungsleistungen nur noch möglich, wenn Kunden aktiv den Anbieter wechseln, was jedoch mit hohen Kosten verbunden ist. Daher liegt es für Versicherer nahe, Versicherungsabschlüsse direkt an alltägliche Kaufentscheidungen zu knüpfen.
Zweitens haben sich die Komforterwartungen der Konsumenten verändert. Immer mehr Kunden möchten ihre Produkte und Dienstleistungen möglichst in einem Kaufvorgang bündeln. Wer online ein Smartphone kauft, erwartet, im selben Checkout-Prozess die passende Versicherung abschließen zu können. Der Abschluss im Supermarkt ist eine logische Erweiterung dieses „One-Stop-Shopping“-Prinzips auf den physischen Einzelhandel.
Drittens ist die wachsende Datenökonomie im stationären Handel relevant. Moderne Kassensysteme dokumentieren heute nicht nur Artikel und Mengen, sondern auch Zeitpunkte, Zahlungsarten und teilweise sogar Wetter- und Standortdaten. Händler können diese Informationen unter strikter Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) mit Versicherern teilen und dafür Provisionen oder Lead-Vergütungen erhalten. Gleichzeitig ermöglichen diese Daten Versicherern, Tarife genauer zu kalkulieren und Risiken präziser zu bepreisen.
Welche Versicherungen passen in den Einkaufswagen?
Nicht jede Versicherung eignet sich für den spontanen Kauf an der Kasse. Am Point of Sale funktionieren vor allem kleinvolumige und leicht verständliche Schadenversicherungen wie ein Display-Schutz, eine Diebstahlversicherung oder eine Reparaturgarantie, die keine umfangreiche Risikoprüfung erfordern und sich digital in Echtzeit abschließen lassen.
Anders verhält es sich bei komplexeren Versicherungen. Eine Kfz-Versicherung etwa verlangt detaillierte Angaben zu Fahrzeug, Halter, Schadenhistorie oder Kilometerleistung. Zudem ist ein umfangreicher Beratungs- und Dokumentationsprozess vorgeschrieben. Am Supermarktregal oder an der Tankstelle dient das Angebot deshalb häufig nur als Leadsammelsystem: Fahrer scannen einen NFC-Chip, hinterlassen Kontaktdaten und schließen den eigentlichen Vertrag später zu Hause oder per App ab. Dieser zweigleisige Ansatz könnte auf absehbare Zeit das Bild prägen: voll eingebetteter Sofortabschluss für einfache Mikro-Produkte und ein hybrider Prozess für beratungsintensive Sparten.
Praktische Umsetzung:
Die E-Bike-Police im Baumarkt
Ein praktisches Beispiel ist der E-Bike-Kauf im Baumarkt. Am Preisschild: „Versichern Sie Ihr Bike gegen Diebstahl und Akkudefekt – ab x,xx Euro im Monat.“ Per QR-Code gelangen Kunden zur Landingpage eines kooperierenden Versicherers und geben dort relevante Daten ein. Eine API berechnet daraufhin in Echtzeit die Prämie. Direkt unterhalb der Preisangabe findet sich der Link zum gesetzlich vorgeschriebenen Produktinformationsblatt (IPID). Ein Klick weiter folgt die Widerrufsbelehrung, dann die Eingabe der Zahlungsdaten. Sekunden später liegt die Police digital vor.
Rechtliche Rahmenbedingungen: Ein dichter Rahmen, aber keine unüberwindbare Mauer
Wer in Deutschland eine Versicherung vermittelt, benötigt eine Erlaubnis nach § 34d Gewerbeordnung. Für Händler eröffnet jedoch der Status des „produktakzessorischen Vermittlers“ eine attraktive Abkürzung. Die Police muss dafür eine Nebenleistung zum Hauptprodukt sein – etwa der Glasbruchschutz zum Smartphone – und ihr Jahresbeitrag darf 600 Euro nicht übersteigen. Unter diesen und weiteren Voraussetzungen ist eine Erlaubnis entbehrlich.
Noch einfacher wird es, wenn der Händler nur als Tippgeber auftritt. Reicht er lediglich einen Flyer oder einen QR-Code weiter ist ebenfalls keine Vermittlungserlaubnis nötig. Die Vergütung beschränkt sich dann allerdings auf eine reine Lead-Prämie.
Die europäische Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD prägt diese Pflichten. Vor jedem Abschluss muss ein „Demands-and-Needs-Test“ stattfinden, der sicherstellt, dass das Produkt zum Bedarf des Kunden passt. Viele Händler lösen das per Multiple-Choice-Dialog auf dem Self-Checkout-Screen. Danach erhält der Kunde das IPID und die allgemeinen Versicherungsbedingungen. Erst dann darf der „Zahlungspflichtig bestellen“-Button erscheinen.
Hinzu kommt die Weiterbildungspflicht: Wer im Markt berät, muss jährlich mindestens fünfzehn Stunden fachliche Schulung nachweisen, zum Beispiel über E-Learning-Module und Interview-Checks durch den Versicherer und eine lückenlose Dokumentation.
Nicht minder komplex ist der Datenschutz. Kundendaten aus Loyalty-Programmen dürfen nur mit ausdrücklicher Einwilligung für Versicherungszwecke genutzt werden. Zwischen Händler und Versicherer ist regelmäßig eine entsprechende Vereinbarung erforderlich, denn beide verarbeiten personenbezogene Informationen entlang eines gemeinsamen Zwecks.
Internationale Perspektiven: Was machen andere Länder anders?
Ein Blick nach Großbritannien zeigt, wohin die Reise regulatorisch gehen kann. Die britische Finanzaufsicht FCA hat 2023 die „Consumer Duty“ eingeführt. Sie verpflichtet Vermittler nachzuweisen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis eines Add-On-Produkts „fair“ ist. Frankreich wiederum kennt seit 2015 die „Loi Hamon“: Sachversicherungen dürfen nach einem Jahr jederzeit gekündigt werden. Retail-Policen müssen das offensiv ausweisen. Eine Supermarktkette wirbt offen damit, dass die Kündigung eines Smartphone-Schutzes per App in dreißig Sekunden möglich ist.
Die Folge: Hohe Transparenz, aber auch hohe Wechselquoten. Die Bundesfinanzaufsicht (BaFin) beobachtet diese Entwicklungen genau und hat bereits angekündigt, sich am britischen Modell zu orientieren. Für deutsche embedded-Anbieter bedeutet das mehr Dokumentation, aber auch Planungssicherheit, weil die Regeln klarer werden.
Zukunftsausblick: Wohin geht die Reise in den nächsten Jahren?
Vieles deutet darauf hin, dass Versicherungen künftig noch tiefer in Produkte eingebettet werden. Hersteller arbeiten an tokenisierten Garantiekarten, in denen Kaufdatum, Zustand und Versicherungsstatus eines Geräts als digitaler Zwilling hinterlegt sind. Ein Schaden ließe sich so in Echtzeit regulieren. Auch der Kfz-Bereich könnte eine Renaissance erleben. An Tankstellen könnten Fahrer per NFC-Zapfsäule einen Versicherungswechsel anstoßen und diesen später automatisiert in der App abschließen.
Ein weiteres Feld ist das „Green Cover“: Wer im Baumarkt eine Photovoltaik-Anlage kauft, soll optional einen Ertragsausfallschutz abschließen können, der über wetterindexbasierte Trigger automatisch auszahlt. Selbst Voice-Assisted-Abschlüsse zeichnen sich ab. Ein smarter Lautsprecher in der Küche könnte fragen: „Möchtest du deinen neuen Mixer gegen Motorbruch absichern? Sag einfach ‚Ja‘.“ Juristisch entsteht sofort ein Fernabsatzvertrag – Identitätssicherung und Aufzeichnungspflicht werden die entscheidenden Knackpunkte sein.
Fazit: Zwischen Komfortversprechen und Compliance-Last
Versicherungen zusammen mit dem Wocheneinkauf „eintüten“ ist mehr als eine nette Idee. Es ist die logische Antwort auf einen gesättigten Markt, neue Datenmöglichkeiten und den Wunsch der Kundinnen und Kunden nach maximaler Convenience.
Rechtlich ist das möglich, aber die Latte liegt hoch: Bedarfsermittlung, Transparenz, Datenschutz und eine saubere Rollenverteilung sind unverzichtbar. Wer diese Regeln einhält, kann „embedded insurance“ profitabel in den Einzelhandel integrieren und von den neuen Möglichkeiten profitieren. Die Zukunft wird zeigen, wie weit diese Entwicklung geht und welche neuen Innovationen noch auf uns warten.

Autor Dr. Ulrich Keunecke ist Rechtsanwalt und Partner bei KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft.