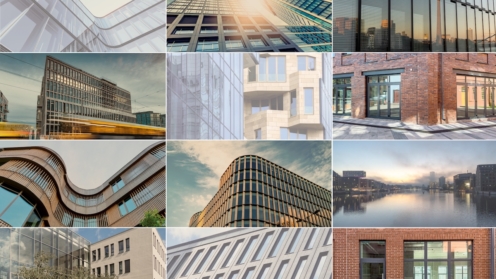Frau Käfer-Rohrbach, sie sagten, dass es immer noch Baugenehmigungen in Zürs-4-Gebieten gibt? Wie kann das sein?
Käfer Rohrbach: Das ist ein Punkt, der mich furchtbar aufregt. Wir haben rund 330.000 Gebäude in amtlich festgesetzten Hochwassergebieten, nicht nur Zürs-Zone 4. Und trotzdem werden jedes Jahr etwa 1.000 bis 1.500 Neubauten in genau solchen Lagen freigegeben. Ich war letztes Jahr als Expertin in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe und habe das angesprochen. Die Antwort mehrerer Ländervertreter: „Da steht ja schon ein Haus, wie sollen wir dem Nächsten das Bauen verbieten?“ Doch, genau das müsste man tun. Ich habe vorgeschlagen, ein Naturgefahrenportal zu schaffen, über das jeder sehen kann, wo Risiken bestehen. Dann fragt vielleicht auch mal jemand bei der Gemeinde nach: „Gilt das als Hochwassergebiet?“ Das Umweltministerium entgegnet: „Dann verlieren Grundstücke an Wert.“ Ja, aber nur, weil es endlich transparent wird. Und ehrlich gesagt, genau dieses Wegschauen bringt uns nicht weiter. In solchen Fragen sind die Schweizer deutlich weiter. Wenn es dort zur Totalzerstörung kommt, schaut man gemeinsam mit der Gemeinde nach Ausweichgrundstücken und schafft realistische Alternativen. Genau da müssen auch wir hin. Wir müssen uns an manchen Stellen ehrlich machen. Denn das Ahrtal ist leider eine Katastrophe auf Wiedervorlage.
Billerbeck: Frau Käfer-Rohrbach, in der Gebäudeversicherung gilt ja normalerweise: Wiederaufbau am selben Ort, in gleicher Art und Güte – innerhalb von drei Jahren, früher waren es sogar nur zwei. Gilt das eigentlich auch bei Elementarschäden? Wissen Sie, ob das in den Standardbedingungen so geregelt ist? Falls ja, wäre es doch sinnvoll, genau da anzusetzen und die Bedingungen zu ändern – etwa so, dass ein Wiederaufbau auch an einem besseren, risikoärmeren Ort möglich wäre.
Käfer-Rohrbach: Gerade im Ahrtal haben wir erlebt: Hätten uns Betroffene ein anderes Grundstück genannt, hätten wir auch dort aufgebaut, trotz der Drei-Jahres-Frist. Viele hatten mit psychischen Belastungen zu kämpfen, da spielt die Zeitgrenze oft keine Rolle mehr. Wichtig ist, dass es Kontakt gibt, ein Gespräch darüber, wo man steht. Dann lässt sich vieles regeln. Und ich würde sagen: In unseren Musterbedingungen ist der Wiederaufbau an einem anderen Ort klar genannt.
Billerbeck: Aber das ist nicht vertraglich.
Käfer-Rohrbach: Ich kann den Versicherern aus kartellrechtlichen Gründen nicht vorgeben, was sie versichern. Aber wenn ein alternatives Grundstück da ist, bauen viele dort wieder auf. Interessant ist: Bei den staatlichen Hilfen im Ahrtal war genau das nicht möglich, da musste eins zu eins am gleichen Ort wieder aufgebaut werden.
Obermayer: Wir allen haben gesehen, was im Ahrtal passiert ist – die Bilder, die Schäden, der Wiederaufbau, mit wenigen Ausnahmen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in Richtung eines Präventionszertifikats denken – um Prävention transparenter und greifbarer zu machen. Elementarschutz allein reicht nicht.

Wir brauchen die Kombination aus Versicherungsschutz und aktiver Vorsorge. Und das geht weit über eine gewartete Rückstauklappe hinaus. Auch die Kommunen müssen mitziehen – beim Bauen, bei Frühwarnsystemen, bei der Aufklärung. Und wir sollten über Belohnungssysteme im Schadenfall sprechen: Wer vorgesorgt hat, wird dafür anerkannt. Das wäre ein sinnvoller Impuls und genau der Mindset, in den wir kommen müssen.
Klug: Es gibt Präventionsmaßnahmen, die man pauschal allen empfehlen kann, weil sie grundsätzlich sinnvoll sind. Aber jedes Grundstück, jedes Haus ist eben anders. Deshalb finde ich: Man sollte auch individuelle Vereinbarungen ermöglichen, die genau auf die jeweilige Situation vor Ort abgestimmt sind.
Obermayer: Unbedingt. Ein Beispiel: Bei uns ist ein Vorsorgebudget von 400 Euro alle drei Jahre geplant. Damit können Kunden einen Sachverständigen oder Ingenieur beauftragen – je nach individueller Situation – und ein Beratungsgespräch führen, unabhängig vom Versicherer.
Denn oft unterstellen Kunden dem Versicherer, er wolle nur Geld verdienen. Dabei ist die Wohngebäudeversicherung längst kein profitables Geschäft mehr. Uns geht es darum, Objektivität in die Beratung zu bringen – und Vertrauen. Viele hören eher auf den Handwerker ihres Vertrauens als auf uns. Und das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist nur: Der Kunde soll erkennen, dass er selbst Verantwortung übernehmen und mitgestalten kann. Er ist am Ende seines eigenen Glückes Schmied.
Käfer Rohrbach: Der Punkt ist absolut relevant: Uns fehlt bislang eine klare Definition von klimaresilientem Bauen und genau da liegt das Problem. Während es viele Vorgaben zur energetischen Sanierung gibt, ist das Thema Klimafolgenresilienz weitgehend ungeregelt. Hausbesitzer stehen oft ratlos da. Das beginnt schon bei Baumaterialien. In Österreich etwa wird seit Jahren Hagelklimatologie betrieben. Dort werden Dachziegel auf ihre Widerstandsfähigkeit getestet – die stabileren Modelle bleiben im Land, die weniger robusten landen bei uns. Auch bei Baumaterialien gibt es große Unterschiede. In Bayern standen Häuser teils zwei Wochen im Wasser, einige davon mit Hochlochziegeln gebaut. Ein tolles dämmendes Material, aber das Wasser bei Überschwemmungen ist verunreinigt. Die Folge: Abriss, weil der Dreck und Feuchtigkeit nicht mehr aus den Hohllochziegeln rausgingen. Wir brauchen klare Vorgaben in Bauordnungen, verständliche Standards für klimaresiliente Materialien und Ingenieure, die auf diesem Stand sind. Nur so können Bauherren sich wirksam schützen.
Das klingt danach, als ob wir auf politischer und kommunaler Ebene noch deutlichen Nachholbedarf haben?
Käfer-Rohrbach: Die Kommunen vergeben die Baugebiete – da haben selbst die Länder oft keine Informationen. Das macht die Lage so komplex. Wir haben es mit „Moving Targets“ zu tun – ständig beweglichen Zielen, bei denen man erstmal schauen muss, wo man überhaupt ansetzen kann. Genau das macht diese Gemengelage so schwierig. Wir brauchen ein bundeseinheitliches Naturgefahrenportal. Es würde Transparenz schaffen – und damit auch Druck erzeugen, als erster wichtiger Schritt. Darauf aufbauend muss der Bund den planerischen Rahmen vorgeben. Und dann gilt es, die Länder schrittweise mitzunehmen, damit sich das flächendeckend durchsetzt. Anders wird es nicht funktionieren.
Billerbeck: Die Wohnungswirtschaft wäre sicher wenig begeistert, Frau Käfer-Rohrbach, wenn es heißt, es brauche neue Auflagen beim Bauen. Ich erinnere mich an eine Diskussionsrunde, in der ein Vorstand sagte: Früher kostete eine neue Gasheizung nach einem vollgelaufenen Keller 7.000 Euro. Heute, mit Wärmepumpe und Heizungsgesetz, sind es schnell 40.000. Das treibt nicht nur die Schadenkosten, sondern auch die Regulierungskosten massiv in die Höhe. Deshalb würde ich vor zu viel neuer Bürokratie warnen. Stattdessen könnte man über höhere Selbstbehalte mehr Eigenverantwortung fördern: Wer einen Schaden hat, soll auch den Schmerz spüren – und daraus Motivation zur Prävention ziehen. Individuelle Beratung klingt gut, aber wir verlieren diese Individualität zunehmend. Die Versicherer wollen einfache, standardisierte Produkte, weil sie sie sonst nicht mehr verwalten können. Vielleicht ließe sich über klar definierte Obliegenheiten – wie eine regelmäßig gewartete Rückstauklappe – ein Baukastensystem schaffen. Aber auch das ist haftungstechnisch nicht ohne. Einfach ist das alles nicht, deshalb sprechen wir heute so intensiv darüber.
Käfer-Rohrbach: Ich wollte gar keine neuen Regelungen fordern, im Gegenteil: Ich halte es für sinnvoll, das Baurecht grundsätzlich zu entrümpeln. Ich bin keine Freundin davon, alles beim Alten zu lassen. Wir sollten bestehende Regelungen und Normen kritisch prüfen und ein Zielbild entwickeln: Was brauchen wir eigentlich wirklich für den Bau? Und mit Blick auf Prävention nur ein kurzer Hinweis: Das amerikanische National Institute of Building Sciences hat in einer Studie gezeigt, dass ein investierter Euro in Hochwasserschutz im Schnitt sechs Euro an Schäden verhindern kann. Das zeigt, wo der Hebel liegt und dass wir gezielt investieren sollten, statt immer nur zu reagieren.
Obermayer: Nur zur Klarstellung, Herr Billerbeck: Uns geht es um den Hebel. Die Produkte müssen einfach und klar verständlich sein, ohne Komplexität, aber flexibel genug, um sich an die Bedürfnisse der 22,5 Millionen Haushalte anpassen zu lassen. Entscheidend ist: Der Kunde soll das Produkt so gestalten können, wie er es braucht. Es reicht, wenn er zum Beispiel eine Rechnung für eine Maßnahme einreicht – nicht, dass jede Rückstauklappen-Wartung ins Bonusheft muss, nur um 0,2 Prozent Prämie zu sparen. Es braucht eine ganzheitliche, praxisnahe Lösung.
Thema Pflichtversicherung. Die Bundesregierung spricht sich dafür aus. Was spricht für den Ansatz was dagegen, Frau Klug?
Klug: Der VZBV hat ein Modell entwickelt, das einer „Halbpflichtversicherung“ ähnelt: Bei neuen Verträgen ist die Elementarschadenversicherung automatisch dabei, bestehende Verträge folgen nach einer Übergangsfrist. Die Idee: Es soll möglichst ohne eine echte Pflicht funktionieren, vorausgesetzt, alle Akteure ziehen mit. Dieses Modell gilt als das mildere Mittel, zumal es bei der Pflichtversicherung verfassungsrechtliche Bedenken gab. Der Ansatz ist daher: Schritt für Schritt vorgehen und erst prüfen, ob es auch ohne verbindliche Pflichtregelung funktioniert, auch wenn es faktisch stark in diese Richtung geht. Pflicht ist ein schwieriges Wort.

Wir haben früher schon diskutiert, ob man nicht besser mit einer verpflichtenden Privathaftpflicht beginnt, einer Versicherung, die jeder braucht, aber die trotzdem keine echte Pflicht ist. Auch bei den Verbraucherzentralen gibt es unterschiedliche Meinungen: Einige fordern eine Pflichtversicherung für Elementarschäden, der VZBV sieht das differenzierter. Das Modell der „Halbpflicht“ über ein Opt-out-System könnte ein guter Kompromiss sein. Erste politische Signale gehen in diese Richtung.
Käfer Rohrbach: Ich habe den Vorschlag eher als Angebotspflicht mit Opt-out verstanden – keine echte Pflichtversicherung.: Nur, das allein löst das Problem nicht. Was viele vergessen: Eine Pflichtversicherung wäre ein massiver Eingriff in die Vertragsfreiheit. Rund 56 Prozent der bestehenden Verträge, also etwa zehn Millionen, müssten rechtssicher umgestellt werden. Das ist mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden: Wer ist versichert? Mit welchem Mindestschutz? Was passiert bei Nichtzahlung? Zudem geht es erstmals um die Pflicht zur Absicherung von Eigentum, anders als bei Kfz, wo es um den Schutz Dritter geht. Verfassungsrechtlich ist das heikel, Klagen wären vorprogrammiert. Deshalb mein Plädoyer: Wir sollten die Versicherungsdichte anders erhöhen. Die Branche will mehr Schutz bieten – aber nicht mit der Brechstange. Wenn freiwillige Lösungen scheitern, kann man weiterdenken. Doch nur an der Versicherungsschraube zu drehen, greift zu kurz.
Obermayer: Frau Käfer-Rohrbach hat völlig recht. Klar ist aber auch: Der Markt würde sich komplett neu sortieren. Wahrscheinlich bräuchte es ein Sonderkündigungsrecht, und wir bei der Bayerischen sehen uns dabei eher als Angreifer. Diese Neuordnung bringt auch Chancen – gerade für uns. Ein weiterer Punkt: Was ist mit den 500 Milliarden Euro Investitionen in Infrastruktur? Bleibt davon etwas für echte staatliche Prävention übrig? Und dann wäre noch die Frage, wie gehen wir mit Mietverhältnissen um? Wer trägt die Verantwortung, wenn ein Gebäude vermietet ist? Ich möchte dazu ein Bild skizzieren: In den 70ern wurde die Anschnallpflicht eingeführt – zuerst auf den Vordersitzen, später hinten. Damals wurde darüber gelacht, aber sie hat gewirkt. Die Frage ist: Brauchen wir so eine „Anschnallpflicht“ oder eine „Helmpflicht“ auch im Versicherungskontext? Oder appellieren wir weiterhin nur an die Selbstverantwortung der Kundinnen und Kunden?
Klug: Unser Modell ist im Grunde eine Anschnallpflicht durch die Hintertür: Man schnallt den Verbraucher quasi von hinten an – über die verpflichtende Elementardeckung bei Neuverträgen und später eine schrittweise Umstellung im Bestand. Ich glaube, wir kommen um so ein Vorgehen langfristig nicht herum, weil Eigenverantwortung oft nicht so funktioniert, wie wir es uns wünschen. Wichtig ist mir: Wir müssen endlich ins Handeln kommen. Kommunen, Länder, Bund, Versicherer und Verbraucher, alle müssen ihren Teil leisten.
Billerbeck: Ich bin grundsätzlich dagegen, dass der Staat alles regelt. Eine Pflichtversicherung würde einen enormen Verwaltungsapparat nach sich ziehen: Wer hat abgeschlossen, was genau ist versichert, wie wird bei Nichtzahlung reagiert? Wir vom BDVM lehnen das klar ab. Stattdessen setzen wir uns für ein Opt-out-Modell auch im Bestand ein. Und ja, für Risikozonen wie Zürs 3 und 4 braucht es Sonderlösungen. Aber alles in die Versicherung zu zwingen, ist wirtschaftlich unsinnig, das würde Anbieter abschrecken. Schon jetzt ziehen sich einige aus der Gebäudeversicherung zurück. Eine Pflichtversicherung könnte zu einem Oligopol führen, mit sinkendem Wettbewerb und steigenden Preisen. Wir müssen endlich loslegen und nicht abwarten und schauen was passiert, wenn der Rhein wieder über die Ufer tritt. Das Thema ist angekommen.
Eine staatlich regulierte Pflichtversicherung mit Rückversicherung durch den Staat, wie man es in Frankreich ja beispielsweise hat, wäre für Deutschland also keine Option?
Billerbeck: Das französische Modell kommt vorne und hinten nicht zurecht. Die müssen auf 20 Prozent anheben und dann ist Prävention spielt nur noch eine nachgeordnete Rolle. Wenn ich höre von Frau Käfer-Rohrbach, dass in Zürs-4-Zonen nach wie vor gebaut werden kann, finde ich das fassungslos. Das war mir bislang so nicht bekannt. Das ist unglaublich und das ist ja keine Lösung. Ich glaube, Tschechien oder Polen hat eine Pflichtversicherung und bei dem Hochwasser haben sie jetzt festgestellt, dass es da eine Pflichtversicherung gibt, aber dass ein Großteil gar keine abgeschlossen hat, weil sie es nicht richtig kontrolliert haben. Der Staat sollte nur das regeln, hier geht es jetzt nicht um Leben und Tod, sondern hier geht es um kaputte Gebäude und das muss auf jeden freigestellt sein, zu sagen, ich gehe das Risiko ein oder nicht.
Obermayer: Und ob sich das französische Modell bewährt, werden wir jetzt erst in Zukunft sehen. Ich meine, die letzten Jahre war es verhältnismäßig einfach. Und selbst da war es ja nicht auskömmlich.
Käfer-Rohrbach: Das französische System ist kein privatwirtschaftliches, kennt aber auch keine echte Pflichtversicherung. Es ist ein Mischmodell: Sturm, Hagel oder Leitungswasser sind privat versichert, Überschwemmung und Erdbeben übernimmt ein staatliches System mit unbegrenzter Deckung. Doch auch dieses Modell gerät unter Druck – das Finanzministerium bringt regelmäßig neue Präventionsmaßnahmen auf den Weg. Ein einfaches Kopieren geht bei uns nicht, das System ist historisch gewachsen. Was wir brauchen, ist ein solidarischer Ansatz mit risikobasierten Prämien. Großbritannien zeigt mit „Flood Re“ einen praktikablen Weg: Es greift nur bei Höchstrisiken, Neubauten in diesen Zonen sind verboten. Die Schweiz denkt ähnlich. Klar ist: Bestehende Gebäude müssen versichert werden, aber Neubauten in Hochrisikozonen dürfen wir uns nicht mehr leisten. Das System muss flexibel und regelmäßig angepasst werden, da sich Risiken durch den Klimawandel verschieben. Wichtig ist, dass Bund, Länder, Versicherer und Verbraucherschützer ideologiefrei zusammenarbeiten – für bezahlbaren, langfristigen Schutz.
Und wie könnte ein tragfähiges Modell aussehen?
Klug: Wie schaffen wir es endlich, alle an einen Tisch zu holen, ohne dass persönliche Eitelkeiten und Befindlichkeiten im Weg stehen? Einfach mal all das beiseite schieben und wirklich pragmatisch, lösungsorientiert gemeinsam anpacken. Genau daran scheitert es oft: Jeder bringt Zwischentöne ein, jeder will seine Position durchsetzen und am Ende kommen wir wieder nicht vom Fleck.
Käfer Rohrbach: Wir brauchen eine Lösung, die alle aus den festgefahrenen Positionen herausholt. Entscheidend ist: Wir müssen pragmatisch vorgehen. Wir sind dazu auch mit dem VZBV im Austausch – und ehrlich gesagt gar nicht so weit auseinander. Uns eint das Ziel, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Ich hoffe, dass die nächste Bundesregierung hier Bewegung reinbringt und endlich alle an einen Tisch holt. Oder wir probieren es anders, wie in der Schweiz: Dort wurde ein außerparlamentarischer Planungsrat gegründet – mit Kantonen, Bund, Versicherern, Verbraucherschützern, Wetterdienst und Planern. Unabhängig von Wahlzyklen entwickeln sie gemeinsam tragfähige Konzepte. Vielleicht wäre das auch für Deutschland ein Weg.
Obermayer: „Probieren“ ist genau das richtige Stichwort. Was wir brauchen, ist eine gemeinsame Sprache – zwischen Versicherern, Politik, Kommunen und Bürgern. Es geht darum, gemeinsam eine tragfähige Lösung zu entwickeln. Unsere größte Sorge als Versicherer ist, dass sich eine Art All-inclusive-Mentalität einschleicht: Alles ist versichert, keiner muss sich mehr kümmern. Genau das ist auch die Schwäche des französischen Modells – Prävention rückt in den Hintergrund, gerade staatlich. Deshalb ist es so wichtig, dass alle Beteiligten miteinander sprechen und Verantwortung teilen. Sonst bleibt es bei kurzfristigem Aktionismus ohne echte, nachhaltige Verbesserung.
Billerbeck: Ich möchte noch einen Punkt anmerken: Zone 4 umfasst oft attraktive Lagen mit Wasserblick. Wenn man in Timmendorf einen drei Meter hohen Deich bauen müsste, würden viele wohl sagen: „Dann verzichte ich lieber auf die Elementarversicherung und nehme das Risiko in Kauf, Hauptsache, die Aussicht bleibt.“ Eine Pflichtversicherung sollte allenfalls für Zone 4, eventuell auch 3, diskutiert werden, etwa mit gedeckelten Leistungen oder Zeitwertregelungen. Für 98,4 Prozent der Gebäude in Zone 1 und 2 braucht es keine Pflicht – das lässt sich privat lösen. In Hochrisikozonen muss man unterscheiden: Handelt es sich um ein Ferienhaus oder um Existenzen? Danach sollte sich staatliche Unterstützung richten. Und ist es gerechtfertigt, auf eine existenzielle Absicherung wie die Elementarversicherung 19 Prozent Steuer zu erheben? Eine Senkung wäre ein starkes Signal, gerade, wenn der Staat über Milliardenhilfen spricht.
Dieser Artikel ist Teil des EXTRA Elementarversicherung. Alle Artikel des EXTRA finden Sie hier.