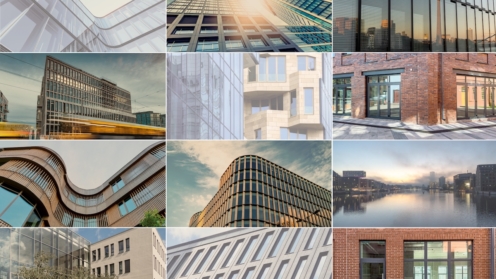Auch das 3. Quartal hat ein leicht positives Gesamtbild für europäische Unternehmen gezeichnet: moderates Wachstum, solide Bilanzen und gleichzeitig große Unterschiede unter der Oberfläche. Europa hinkt den USA bei der Dynamik der Unternehmensgewinne zwar hinterher, die Kreditwürdigkeit der Unternehmen wird dadurch aber nicht beeinträchtigt. Die meisten Emittenten mit guter Bonität refinanzieren niedrig verzinste Anleihen zu nur leicht höheren Gesamtkosten. Gleichzeitig nutzen sie ihre laufenden Mittelzuflüsse, um den Verschuldungsgrad stabil zu halten und dennoch Investitionen zu finanzieren.
Die besten Zahlen kamen aus den Sektoren Rüstung, Investitionsgüter und Gesundheit: Unternehmen wie Leonardo und Airbus profitierten von gut gefüllten Auftragsbüchern und einem kräftigen Barmittelzufluss. Roche und Novartis verwandelten ein moderates Umsatzwachstum dank hoher Margen in einen robusten freien Cashflow. Die Automobil- und die Chemiebranche hingegen standen unter Druck. Sie sahen sich im 3. Quartal mit schwächerer Nachfrage, wachsender Konkurrenz aus China sowie höheren Energie- und Regulierungskosten konfrontiert. Das Fazit lautet daher: Widerstandsfähigkeit ohne große Dynamik. Und damit wird der Ausblick auf die nächsten zwölf Monate wichtiger als der Rückblick.
Stabiles Wirtschaftswachstum der Eurozone als Basis
Im Jahr 2026 ist unser konjunkturelles Basisszenario für die Eurozone geprägt von niedrigem, aber stabilem Wachstum auf einem Niveau von etwa 1,8%: Die Inflation steigt moderat auf 2,3% und die Leitzinsen bleiben unverändert. Die entscheidenden Unterschiede bei den Unternehmensergebnissen entstehen dabei nicht durch den Konjunkturzyklus, sondern durch Politik, Investitionsbedarf und Handelsströme. Viele Unternehmen in Europa gehen mit soliden Bilanzen in diese Phase. Erfolgreich werden sie aber nur dann sein, wenn sie sich mit drei Herausforderungen auseinandersetzen: der zunehmenden Zersplitterung der Wirtschafts- und Handelspolitik, der Investitionswelle an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz, Energie und Infrastruktur sowie der Neuordnung der Lieferketten.
Exportorientierte Unternehmen unter Druck
Eine stärker auf den Heimatmarkt konzentrierte Industrie- und Handelspolitik wird in den nächsten Quartalen das Umfeld für exportorientierte Unternehmen schwieriger machen. So können Zölle, Vorgaben zu lokalen Wertschöpfungsanteilen und Exportkontrollen die Wettbewerbsposition einzelner Unternehmen rasch verändern und die Margen in exportorientierten Branchen unter Druck setzen.
Autoindustrie im Zentrum der Herausforderungen
Offensichtlich ist dies bei der Automobilindustrie: Für Konzerne wie Volkswagen, Renault, Stellantis und BMW geht es 2026 weniger um Volumenwachstum, sondern vor allem um Effizienzgewinne. Die Hersteller müssen Kapazitäten in Europa bündeln und ihre Modellpaletten batterieelektrischer Fahrzeuge auf skalierbare Plattformen zurechtstutzen. Zudem gilt es, wertvernichtende Preiskriege zu vermeiden. In den Zahlen zum 3. Quartal ist bereits eine nachlassende Preissetzungsmacht und ein stärkerer Fokus der Automobilhersteller auf den freien Cashflow zu erkennen. Die Margen der Autohersteller werden unter Druck geraten, was ihre Bonität belastet. Bei den Zulieferern werden sich die Ergebnisse in den nächsten Quartalen weiter auseinanderbewegen: Unternehmen wie Continental, Aptiv und Autoliv stehen zwar unter Preisdruck durch die Hersteller. Gleichzeitig steigt aber der Wertschöpfungsanteil pro Fahrzeug – durch Elektrifizierung, fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme sowie Sicherheitstechnik –, was den positiven mittelfristigen Ausblick unterstützt. Die Quartalsberichte aus dem Zuliefererbereich zeigen robuste Auftragsbestände. Zugleich blieben die Investitionen eng an bereits vergebene Programme gekoppelt. Das dürfte vor allem Continental, Aptiv und Autoliv dabei helfen, die Verschuldung auch 2026 unter Kontrolle zu halten.
Grundstoffindustrie profitiert von Kupfernachfrage
Die Grundstoffindustrie steht vor einem Jahr mit niedrigem Wachstum und hoher Unsicherheit. Kupfer bleibt jedoch ein relativer Lichtblick, da Elektrifizierung, erneuerbare Energien und der Ausbau von Rechenzentren die Nachfrage stützen. Neben Glencore dürften auch andere große Bergbaukonzerne wie Rio Tinto, BHP und Anglo American von ihrer ausgeprägten Kupferexponierung profitieren. In Europa sind zudem Aurubis und Boliden als Gewinner eines strukturell steigenden Bedarfs an Kupfer und Recyclingkapazitäten zu nennen.
Im Stahlbereich zahlt sich Spezialisierung aus
Im Stahlbereich bleibt die Lage fragil: Für ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine sowie weitere europäische Produzenten wie Salzgitter könnte eine vorsichtige Erholung im Bauwesen und in der Automobilindustrie die Auslastung verbessern. Die Erträge bleiben jedoch anfällig für den anhaltend hohen Exportdruck aus China und mögliche neue handelspolitische Maßnahmen. Die Ergebnisse des 3. Quartals haben diese Spaltung bestätigt: bessere Signale bei Kupfer und höherwertigen, spezialisierten Stahlsorten, schwächere bei Standard- und Massenstählen. Portfoliobereinigungen und der Fokus auf höherwertige, CO₂-ärmere Produkte werden in den kommenden zwölf Monaten für die Bonität der Stahlproduzenten wichtiger sein als das Streben nach Volumen um jeden Preis.
Regulierte Infrastruktur: Netzentgelte entscheidend
In regulierten Infrastruktur-Bereichen wirken politische Entscheidungen sich unmittelbar auf die Erträge aus. Die jüngste Ratingherabstufung von Enexis durch Moody´s hat gezeigt, wie die Ausgestaltung von Netzentgelten und die Verzinsung des regulierten Vermögens den Puffer im Konjunkturverlauf aufzehren können. Umgekehrt können Versorger mit verlässlichem Regulierungsrahmen und klarer politischer Unterstützung für netzseitig rechenzentrumsfähige Infrastruktur und den Ausbau erneuerbarer Energien ihre Vermögensbasis vergrößern und gleichzeitig ihre Bonität wahren: etwa Enel und RWE. Terna, National Grid und Elia gehen mit umfangreichen Netzausbauprogrammen in das Jahr 2026. Anleiheninvestoren sind darauf angewiesen, dass die Regulierungsbehörden die Netzentgelte so festlegen, dass sie im Einklang mit dem notwendigen Netzausbau stehen.
Der wichtigste Umsatztreiber dürfte im Jahr 2026 aber der Investitionssuperzyklus sein: die Investitionen rund um Energiewende und digitale Infrastruktur. Der wachsende Einsatz von Künstlicher Intelligenz und großen Cloud-Rechenzentren erhöht die europäische Nachfrage nach Strom, Konnektivität und spezialisierter Ausrüstung.
Zu den Gewinnern in diesem Segment dürften ABB, Siemens und Schneider Electric gehören, die auch in den kommenden Quartalen von einer robusten Nachfrage in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung profitieren sollten. Siemens Energy erwartet, dass die derzeitigen Rekordauftragsbestände im Übertragungsnetz durch anhaltend hohe Investitionen in Netz-Infrastruktur weiter untermauert werden. Die Kabelhersteller Prysmian und Nexans sind mit mehrjährigen Verpflichtungen in Hochspannungsprojekten gut positioniert, um vom Ausbau der Netze langfristig zu profitieren. Insgesamt spricht dies für ein stetiges Anleihenangebot und ein nachhaltig wachstumsorientiertes Geschäftsmodell, das mit stabilen Bonitätseinstufungen gut vereinbar bleibt.
Industriegüter und Dienstleistungen: Investitionsdisziplin und Spezialisierung
Weiter unten auf der Wertschöpfungskette erwarten europäische Hersteller elektrischer Ausrüstung, Anbieter von Energiemanagementlösungen und technische Dienstleister, dass sich die Investitionswelle ab 2026 stärker in höheren freien Barmittelzuflüssen niederschlägt. Hierzu zählen die großen Vermieter für Bau- und Industrieausrüstung – Loxam, Kiloutou, Boels und Renta. Sie dürften ihren Kurs in den kommenden Quartalen fortsetzen: ihre Investitionen in den Fuhrpark disziplinierter steuern, die Auslastung stabilisieren und den Schwerpunkt weiter auf spezialisierte Nischen verlagern, die eng an Infrastruktur- und Industrieprojekte gekoppelt sind. Damit sollte sich ihre finanzielle Entwicklung auch künftig als widerstandsfähig erweisen, selbst wenn der Wohnungsbau strukturell verhalten bleibt.
Lange Lieferverträge helfen Halbleiterherstellern
Auch bei den europäischen Halbleiterherstellern zeichnet sich derselbe Trend am Anfang der Wertschöpfungskette ab: Anders als NVIDIA werden Infineon und STMicroelectronics sich voraussichtlich weiter auf Leistungs- und Auto-Halbleiter fokussieren, die in Stromnetzen, Stromversorgungssystemen von Rechenzentren sowie in elektrischen Antriebssträngen von Fahrzeugen eingesetzt werden. Ein solider Produktmix und mehrjährige Lieferverträge sprechen dafür, dass Umsatz- und Ergebnisbeiträge aus diesen Anwendungen in den kommenden Jahren gut planbar bleiben und die hohen Investitionen im Zusammenhang mit der Elektrifizierung und dem Ausbau von Rechenzentren sichern.
Logistiker profitieren von Neuordnung der Lieferketten
Die Automobilindustrie steht im Zentrum der Lokalisierung von Lieferketten. Die Zulieferer richten Standorte und lokale Wertschöpfung daran aus, wo die jeweiligen Hersteller ihre Fahrzeugplattformen produzieren. Reedereien im Fernverkehr passen sich diesem Trend eher an, als ihn voranzutreiben. Maersk und Hapag-Lloyd stellen Vertragsqualität und Cashflow vor Marktanteile, da die starke Abhängigkeit vom weltweiten Handel zunehmend zum Gegenwind wird. Im Jahr 2026 dürften vor allem Logistiknetzwerke, die auf regionale, wertschöpfungsintensive Dienstleistungen ausgerichtet sind, vom Onshoring-Trend profitieren: DSV und Deutsche Post DHL nutzen grenzüberschreitende Straßen- und Schienenverkehre sowie Speditions- und Kontraktlogistikgeschäfte. Kühne+Nagel setzt auf Pharmalogistik und Transporte, die den Transport von Waren bei einer konstanten Temperatur sicherstellen, um die Qualität zu erhalten. DFDS profitiert von Kurzstrecken-Seeverkehren und Fährverbindungen für Güter, die überwiegend per Lkw oder Bahn transportiert werden.