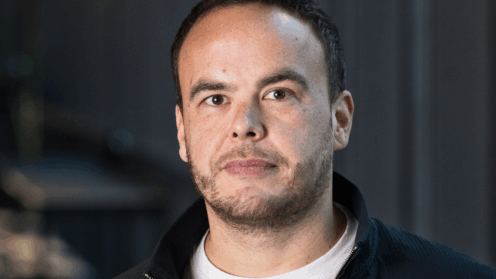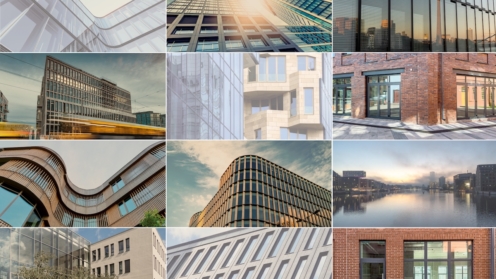Welches sind aktuell die größten Baustellen der Branche?
Van Lancker: Neben dem digitalen Abschluss ist vor allem die Digitalisierung der Bestandssysteme eine Herausforderung für die Branche. Vielfach sind ältere Daten und Verträge nicht in den notwendigen Formaten verfügbar. Bei vielen Versicherern laufen jetzt aber Projekte für die Bestandssystem-Migration oder sind teilweise abgeschlossen. Zudem geht es um gute Web-Services, sowohl für Anträge als auch für den Bestand. Wenn das funktioniert, können Vertriebsorganisationen und Maklerverwaltungsprogramme darauf coole digitale Prozesse bauen. Eine Herausforderung sind dabei aber oft auch die Schnittstellen, die Ressourcen und die Infrastruktur auf Seiten des Vertriebs. Zusätzlich ist der Branchenstandard ein weiteres wesentliches Thema.
Inwiefern?
Van Lancker: Wir unterstützen die Entwicklung auch als Mitglied im BIPRO e.V., also dem Brancheninstitut für Prozessoptimierung. Der BIPRO-Standard lässt viel mehr Interpretationen zu als ein Industriestandard zum Beispiel für Steckdosen, die dann wirklich alle gleich sind. In der Versicherungswirtschaft gibt es keinen echten einheitlichen Standard, der bei Versicherer A genauso aussieht wie bei B, C oder D. Das hindert an vielen Stellen noch in der Digitalisierung.
Aber genau diese Einheitlichkeit ist doch das Ziel des Bipro-Prozesses.
Van Lancker: Ja, das hat man auch so weit wie möglich versucht. Trotzdem gibt es viele Individualisierungsmöglichkeiten, die für die Produktentwicklung der Versicherer teilweise auch notwendig sind. Dazu zählt zum Beispiel die Berufeliste in der BU. Mal steht Influencer mit darauf, mal nicht. Mal ist Koch in 18 Unterberufe gegliedert, mal ist es nur eine Berufsbezeichnung. Beispiele gibt es auch in anderen Sparten, etwa eine Hundeliste in der Tierhalter-Haftpflicht oder was im Antrag für eine Grundfähigkeitsversicherung die Fähigkeit „knien“ zu können genau bedeutet. In manchen Fällen ist diese Individualisierung meines Erachtens nicht notwendig, in anderen ist sie sinnvoll, weil sie ein Differenzierungsmerkmal des betreffenden Versicherers ist. Aber solange es die Unterschiede gibt, kann ein Standard nicht so einheitlich sein, wie wir uns wünschen, und bei jeder Vertriebsanbindung sind individuelle Anpassungen erforderlich.
Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz, kurz KI, mittlerweile?
Van Lancker: Vorab: Ich glaube nicht, dass KI ein Allheilmittel für alle Probleme ist. Kaum ein Kunde steht morgens auf und sagt sich zum Beispiel: Heute schließe ich eine BU ab. Er braucht einen entsprechenden Impuls. Doch die KI verkauft keine BU. Dagegen stehen auch die rechtlichen Vorschriften in der Versicherungsvermittlung. Am Ende muss immer ein Vermittler oder Berater die Verantwortung übernehmen. Trotzdem gibt es mit KI entlang der Wertschöpfungskette enorme Chancen. Vor allem lassen sich repetitive Tätigkeiten automatisieren. Wir arbeiten seit zehn Jahren mit KI, insbesondere im Bereich der Texterkennung und -verarbeitung bei der Analyse des Bedingungswerks, etwa zur Stichwortsuche oder zur Identifizierung von Unterschieden. Aber eine KI kann nicht zwischen den Zeilen lesen, nicht Bedeutungen einordnen und nicht ohne Weiteres Querverbindungen herstellen. Deshalb haben wir über 40 Analystinnen und Analysten, die das tagtäglich tun.
Wie lange werden Sie das Analyseteam noch benötigen?
Van Lancker: Ich bin überzeugt, dass wir es noch sehr lange brauchen. KI wird auch in den nächsten Jahren nicht in der Lage sein, in allen Sparten das Bedingungswerk von A bis Z einheitlich zu analysieren. Komposit ist meiner Meinung nach die erste Sparte, in der sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten für KI möglich sind, bei einfachen Lösungen wie dem Wechsel der Kfz-Versicherung. Ein Thema, bei dem KI sehr helfen wird, ist der Bereich der Risikoprüfung, etwa bei der Auswertung und Anonymisierung von Diagnosen und Arztberichten im Rahmen einer Risikovoranfrage. KI kann damit auch Ressourcen frei machen, die für Produktentwicklung, Bewertungsschemata oder Qualitätssicherung genutzt werden können.
Kann KI nicht auch bei der Konkretisierung von Kundenwünschen und -bedürfnissen sowie der Auswahl entsprechender Produkte nützlich sein?
Van Lancker: Dafür nutzen wir heute noch keine KI. Wir haben aber schon Use Cases mit Maklern und Versicherern durch klassische Chatbots umgesetzt. In unseren Tools stehen außerdem Zielgruppen-Profile der Franke und Bornberg GmbH zur Verfügung. Nehmen wir als Beispiel wieder die BU. Beamte, Angestellte oder Selbständige haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse, ebenso Singles und Familien. Gleiches gilt etwa bei Haftpflicht oder Hausrat. Das kann ein Chatbot abfragen. Ich sehe derzeit aber noch keine KI, die das tiefer herausarbeiten kann.
Wird der Tarifdschungel durch Digitalisierung dichter oder lichter?
Van Lancker: Beides. Auf der einen Seite ermöglicht Digitalisierung eine immer stärkere Modularisierung der Tarife, die vor allem im Bereich der BU und der Grundfähigkeit bereits sehr ausgeprägt ist. Auf der anderen Seite helfen digitale Tools, aus der Vielzahl von Tarifvarianten, Bausteinen und Kombinationsmöglichkeiten die besten Lösungen für den Bedarf im Einzelfall herauszufiltern. Das ist aber weniger ein KI-Thema, sondern eher die Aufgabe von Vergleichern wie uns.
Welche Rolle spielt bei Ihren Tarifvergleichen der Preis?
Van Lancker: Das ist spartenabhängig. In der Altersvorsorge geht es in erster Linie um die Höhe der garantierten und der möglichen Rente, die für einen bestimmten Beitrag am Ende herauskommt. Daneben geht es auch um die Bedingungsanalyse, aber das ist in der Altersvorsorge nicht das führende Kriterium. Anders ist es im Bereich Arbeitskraftsicherung. Hier richtet sich die Auswahl hauptsächlich nach der Produktqualität. Der Preis ist zweitrangig, jedenfalls für die einzelnen Produkte, also BU, EU oder Grundfähigkeit. Um die drei Produkte gleichzeitig beraten zu können, hat die Franke und Bornberg GmbH einen sogenannten AKS-Index entwickelt, der diese komplexe Welt in einen Preis-Leistungs-Kennwert bringt. Also wie viel Leistung bekomme ich für einen bestimmten Beitrag?
Wie ist die Aufgabenteilung zwischen fb research und der Franke und Bornberg GmbH?
Van Lancker: Wir haben eine klare Aufgabenverteilung, um die Unabhängigkeit des Produktvergleichs und höchste Qualitätsstandards jederzeit zu gewährleisten. fb research stellt die quantitativen Aspekte wie Preis, Hochrechnung und Kosten direkt aus dem Webservice der Gesellschaften dar. Die qualitative Bewertung und das Produktrating unterliegen der fachlichen Verantwortung der Franke und Bornberg GmbH, die weiterhin zu 100 Prozent im Besitz von Michael Franke und Katrin Bornberg ist. Damit sind Rating und Erfüllungsgrad vollständig abgesichert – und wir sind der einzige Anbieter, der die Produktbewertung konsequent extern durchführen lässt, also die Unabhängigsten. Seit rund zweieinhalb Jahren gehört fb research zur Swiss Life Deutschland Holding. Eine vertraglich geregelte Informationssperre zwischen fb research und Swiss Life gewährleistet die strikte Datentrennung. Dieses Modell stellt unsere Unabhängigkeit sicher und genießt hohe Akzeptanz im Markt.
Noch ein letztes Stichwort: FiDA, also die geplante europäische Verordnung über den Zugang zu Kunden-Finanzdaten beziehungsweise deren Bereitstellung, damit andere Finanzinstitutionen darauf zugreifen können, englisch: Financial Data Access. Was kommt mit der FiDA-Verordnung auf die Versicherungswirtschaft und den Vertrieb zu?
Van Lancker: Das kommt darauf an, ob überhaupt, wann und in welcher Form FiDA am Ende tatsächlich beschlossen wird und in welchem Zeitrahmen sie dann von den Unternehmen umgesetzt werden muss. Darüber gab es in den letzten Monaten sehr unterschiedliche Informationen. Die Idee dahinter ist gut, ich habe aber die Befürchtung, dass wir bei FiDA in ein ähnliches Problem laufen wie bei der PSD2 für Banken, die eine vergleichbare Zielsetzung hat. PSD2 hat nicht beziehungsweise schlecht funktioniert, weil die Hürden zu hoch und die Vorschriften zu kleinteilig waren.
Wird also auch FiDA scheitern?
Van Lancker: Grundsätzlich liegt in FiDA durchaus eine große Chance. Wenn die Daten zur Verfügung stehen und einfach transportiert werden können, profitieren Vermittler, Kunden und Geschäftsqualität. Doch damit sind wir wieder am Anfang des Gesprächs: Das funktioniert nur, wenn alle Daten – einschließlich Bestandsdaten – vollständig digital zur Verfügung stehen und der Versicherer entsprechende Web-Services anbietet. Davon ist die Branche vor allem in Bezug auf die Bestandsdatenmigration noch sehr weit entfernt. Wenn FiDA in der jetzigen Form kurzfristig umgesetzt werden müsste, wäre das eine enorme Herausforderung für die Branche. Ich bin auch skeptisch, ob eine einheitliche EU-Verordnung, die dann in die deutschen Verhältnisse gepresst werden muss, wirklich eine gute Lösung bringt. Meine Befürchtung ist, dass sie eingedampft wird und eine kleine symbolische Geste wird, die viel Arbeit macht und nichts bringt. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Branche die Digitalisierung in den nächsten Jahren auch ohne eine FiDA sehr gut hinbekommen wird, weil Angebot und Nachfrage genau in diese Richtung gehen. Und sicherlich hilft der Kostendruck auf Versichererseite auch, sich mit ein wenig mehr Tempo zu bewegen.
Dieses Interview stammt aus dem Special Digitalisierung in Cash. 7/2025.